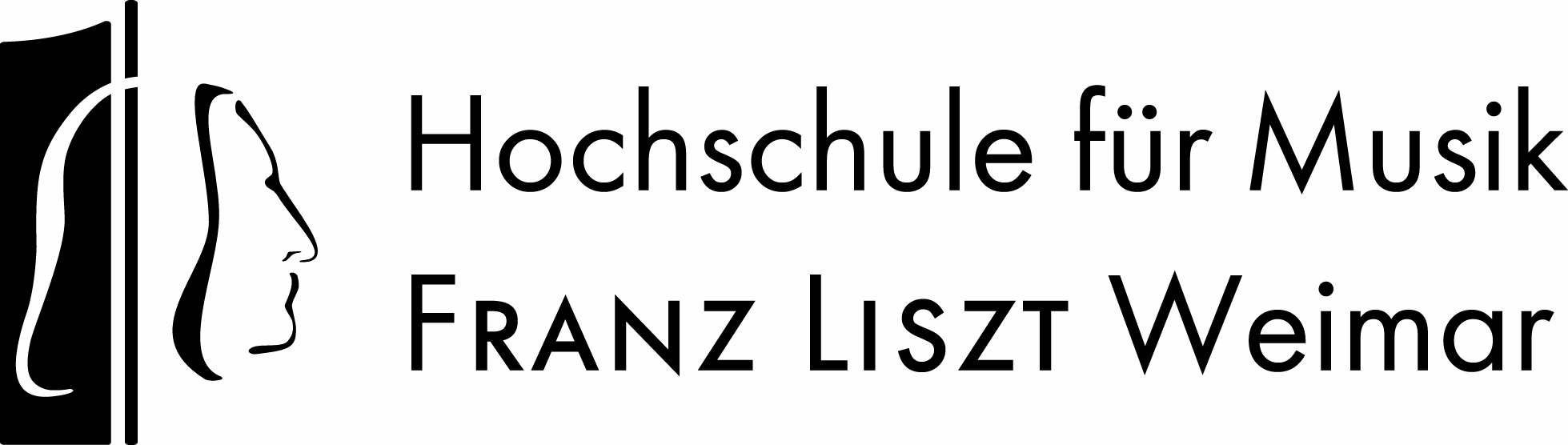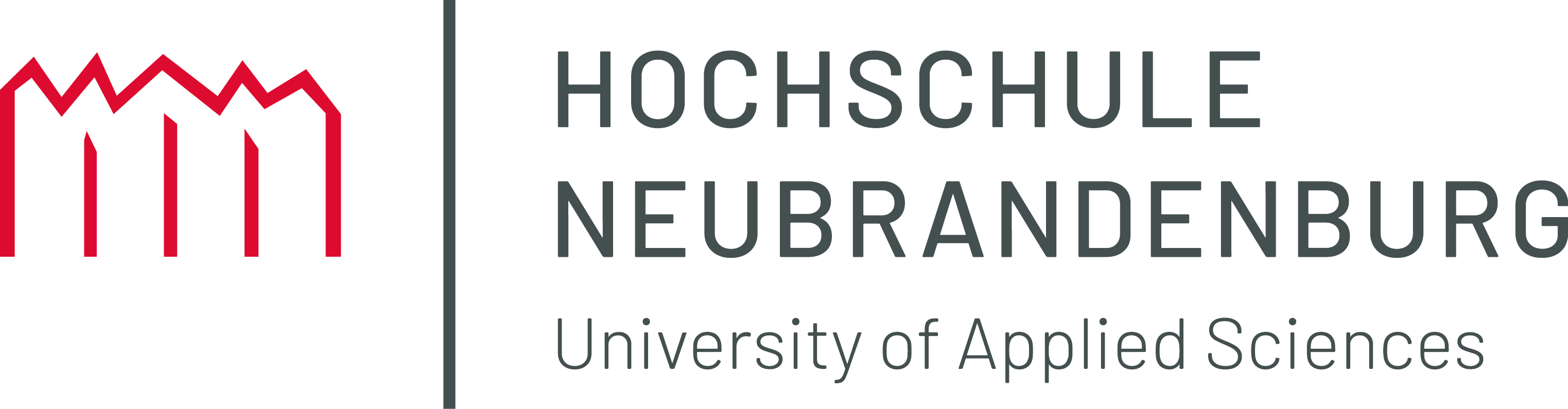Liszt-Rezeption
Zusammenfassung
In den 1950er- und 60er-Jahren wurde Liszt in der DDR zunächst als Sozialrevolutionär und Utopist, aber auch als ‚Klassiker‘ vereinnahmt, der letztlich den Sozialistischen Realismus antizipiert hatte. In den 1980er-Jahren schließlich erstand der Komponist, nachdem es zwischenzeitlich eher still um ihn geworden war, als ‚Romantiker‘ und zugleich als Vertreter einer (relativ-)autonomen Kunst im emphatischen Sinne wieder auf – als jemand, der als Ahnherr der musikalischen Avantgarde auch im eigenen Lande gelten kann. Dabei fällt eine bemerkenswerte Parallele auf: Während der frühen DDR war der Blick vor allem auf den ‚frühen‘ und ‚mittleren‘, in der späten hingegen auf den ‚späten‘ Liszt gerichtet. Zugleich zeigt sich, dass Liszt der offiziellen, linientreuen Musikgeschichtsschreibung zunehmend entzogen wurde, um mit ihm für eine musikalische Autonomie im emphatischen Sinne einzutreten. Hier zeigen sich „Herrschaft“ und „Eigen-Sinn“.Zu dieser Ambivalenz s. Thomas Lindenberger (Hg.): Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, Köln u. a. 1999. Vor allem anhand der Liszt-Jubiläumsjahre 1961 und 1986 lässt sich dies gut nachvollziehen: Immer wieder bezieht man sich in diesen Jahren auf die Tradition, um den eigenen Standort zu bestimmen.
Während die frühe DDR behauptete, Liszts soziale und künstlerische Ideen – Utopien – verwirklicht zu haben oder kurz vor deren Verwirklichung zu stehen, wodurch diese letztlich abgegolten schienen, machte man sich in der späten DDR diesbezüglich keine Illusionen: Die Utopien des 19. Jahrhunderts standen in diesem Jahrzehnt als solche weiterhin (oder erneut), gleichsam uneingelöst, im Raum – das entsprechende musikalische Erbe war demnach also keineswegs verwirklicht oder ‚vollstreckt‘, sondern blieb, was es war: Repositorium nicht erfüllter Träume, zur Zukunft hin offenes Potential. Bemerkenswerterweise erfuhr dabei zugleich auch der Denker des Utopischen, nämlich der nach 1956 in der DDR in Ungnade gefallene Philosoph Ernst Bloch, eine Art unterschwellige Renaissance.Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 143.
1956 – Anfänge
Bis zum 21. Oktober 1956 hatte die Weimarer Hochschule für Musik keinen Namen. Am 22. 10. des Jahres – zu Liszts 145. Geburtstag – fand, im Rahmen einer Festwoche auch zum zehnjährigen Jubiläum der Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg, im Deutschen Nationaltheater (DNT) Weimar ein Festakt zum Zwecke der Namensgebung statt, zu dem namhafte Persönlichkeiten geladen waren; von nun an war die Weimarer Hochschule – nicht zuletzt, weil deren Gründung maßgeblich auf Liszt zurückgeht – „die Liszt-Institution der DDR“.Wolfram Huschke: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010, 318. Neben dem damaligen, mit noch nicht einmal 30 Jahren sehr jungen Hochschulrektor Werner Felix, der kurz darauf auch eine kleine Liszt-Biographie verfasste,Werner Felix: Franz Liszt: Ein Lebensbild, 2. Aufl. Leipzig 1961. Wolfram Huschke kommentiert: „Mangels anderer solcher Arbeiten wurde sie zum nächsten Jubiläum 1986 noch einmal aufgelegt. Weitaus geschickter als in der Festschrift von 1956 beleuchtet Felix hier die historisch vielfältigen Aspekte im scharfen Licht der damaligen kulturpolitischen Doktrinen, ohne dem Gegenstand allzu viel Gewalt anzutun.“ Wolfram Huschke: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010, 320. gab es Ansprachen von Hans Pischner, damals stellvertretender Minister für Kultur, Karl Hossinger, Kulturfunktionär aus Erfurt, dem damaligen Weimarer Oberbürgermeister Hans Wiedemann sowie zweier Vertreter einer ungarischen und tschechischen Delegation, die eigens zum Anlass der Namensgebung nach Weimar gekommen waren.Vor allem für die ungarische Delegation war die Weimarer Reise mit einigen Komplikationen verbunden, da just einen Tag später, am 23. Oktober, ein landesweiter Volksaufstand gegen das ungarische Regime in Budapest blutig niedergeschlagen wurde, so dass man zunächst nicht ins Heimatland zurückkehren konnte.
.jpg)
Man kann die Festreden zur Namensgebung in voller Länge auf der „Tondokumente“-Seite der Hochschule nachhören. Hans Pischner rekurriert dabei in seiner etwa 25minütigen Ansprache ausführlich auf die ‚utopischen‘ Elemente in Liszts Wirken, nimmt vor allem Bezug auf den Einfluss des Saint-Simonismus auf den jungen Komponisten und kommt dann aber zu dem Schluss, dass eben jene Utopie der 1830er-Jahre nun – im Jahr 1956 – zu einer „greifbaren Wirklichkeit […] geworden“ sei; was Liszt für seine Gegenwart, Mitte des 19. Jahrhunderts, u. a. auch mit dem Plan einer Goethe-Stiftung wollte, sei nunmehr, auf sozialistischem Boden, großenteils Realität geworden.https://www.hfm-weimar.de/tondokumente/die-verleihung-des-namens-franz-liszt-an-die-hochschule-im-jahre-1956 (Ansprache von Hans Pischner, ca. 14′05″ bis 15′30″).
Die im musikalischen Erbe (hier: Liszts) formulierte Utopie also wurde aus dieser Perspektive in der Gegenwart eingelöst, in der Idealgesellschaft hat sie den Weg zur Eutopie bereitet, zum „guten Ort“.Zur ‚Eutopie‘ in der DDR vgl. auch Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 148. Gleich zu Beginn von Werner Felix’ achtseitiger Vorrede zur Weimarer Festwoche 1956 wird jener, so Huschke, „katechismusmäßige“ Satz Liszts zitiert, der die Liszt-Rezeption in der DDR zu dieser Zeit auf den Punkt bringt: „Es ist der Satz […], der ‚Zukunftsmusik‘ als erreicht definiert, wenn der Musiker die ‚Saiten seiner Lyra‘ mit der ‚Tonhöhe der Zeiten in Übereinstimmung zu bringen‘ gelernt habe.“Wolfram Huschke: Zukunft Musik. Eine Geschichte der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Köln u. a. 2006, 390 f. Der Komponist galt somit als Sprachrohr seiner Zeit, wobei die Weimarer Hochschulleitung damit vor allem „die ‚neue Zeit‘ mit dem ‚Sieg des Sozialismus‘“ identifizierte.Wolfram Huschke: Zukunft Musik. Eine Geschichte der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Köln u. a. 2006, 390 f. Und so ist es kein Zufall, dass – neben so prominenten Werken wie dem zweiten Klavierkonzert – am Tag des Festaktes Liszts ansonsten selten erklingender, schlicht gehaltener „Arbeiterchor“ für Männerchor mit Bass-Solo und Klavierbegleitung von 1848 aufgeführt wurde. Von diesem Chor hieß es damals in Musik und Gesellschaft, dass dieser „den Einfluß“ beweise, „den die Ideen des utopischen Sozialismus auf Liszt hatten“, zugleich zeuge er „von der aktiven Anteilnahme Liszts am Geschehen seiner Zeit“.[Anonym] (–er.–): Franz-Liszt-Hochschule zu Weimar, in: MuG 6 (1956), 458. Die Karl Marx’sche Nomenklatur, „utopischer Sozialismus“ statt „Frühsozialismus“, wird in der DDR durchgehend übernommen. Der „Arbeiterchor“ entspricht dem Aufbauwillen der 1950er-Jahre nahezu perfekt. Grundsätzlich ging es in Weimar darum, fortan weiterhin im Geiste des Zukunftsmusikers zu wirken, sprich, dessen Ideen – über das bereits Erreichte hinaus – zur Verwirklichung zu verhelfen, etwa durch das Bereitstellen von Kunst für das gesamte Volk.
In der DDR wurde immer wieder die Nähe Liszts zu den französischen, (Juli-)revolutionären Ideen von 1830, zum frühen Sozialismus, zum Saint-Simonismus und zur Arbeiterklasse betont – dies etwa mit Verweis auf das Mitte der 1830er-Jahre komponierte Klavierstück Lyon mit dem Motto der dortigen aufständischen Seidenweber: „Vivre en travaillant ou mourir en combattant“ („arbeitend leben oder kämpfend sterben“). Dieses Motto wird bei Liszt gleich zu Beginn fanfarenartig auskomponiert und am Ende erneut aufgegriffen.

Zudem wurde auf Liszts spätere Affinität zu den Ideen der Revolution von 1848 verwiesen, denen der Komponist – so der Tenor – stets treu geblieben sei. Und schließlich wurde in der DDR schon 1956 immer wieder, und damit eng zusammenhängend, Liszts ungarische Herkunft hervorgehoben, was vor dem Hintergrund der antiformalistischen Anti-Kosmopolitismus-Kampagne in den Ländern des Ostblocks nur konsequent ist. So druckte etwa die Zeitschrift Musik und Gesellschaft in der Dezember-Ausgabe des Jahres einen Artikel des jungen ungarischen Musikwissenschaftlers János Kárpáti ab, in dem es heißt, dass der Ungar und der Revolutionär Liszt deckungsgleich seien; beides sei, wie es am Ende des Beitrags im Superlativ heißt, der „charakteristischste Wesenszug des Lisztschen Werkes“.János Kárpáti: Das Erbe Franz Liszts und die ungarische Musikwissenschaft. Zum 145. Geburtstag und 70. Todestag des Meisters, leicht gekürzte Übersetzung von A. Czongár, in: MuG 6 (1956), 453–256, 456. Zuvor heißt es: „Es kann kein Zufall sein, daß wir, indem wir nach dem Ungar Liszt suchten, bei dem Revolutionär Liszt angelangt sind. Dies ist kein ‚falscher Kreis‘ […]“ (ebd.). Liszts Kompositionsweise wurzele zwar im europäischen Erbe, münde aber „eindeutig und geradlinig in die ungarische Kultur“.János Kárpáti: Das Erbe Franz Liszts und die ungarische Musikwissenschaft. Zum 145. Geburtstag und 70. Todestag des Meisters, leicht gekürzte Übersetzung von A. Czongár, in: MuG 6 (1956), 455. Ähnlich sah dies der damals bereits arrivierte ungarische Kollege Bence Szabolcsi: Bei aller Internationalität und trotz der Tatsache, dass Liszt sich niemals vollständig mit seinem Heimatland identifizierte, sei dieser doch kein heimatloser, sondern vielmehr ein genuin „osteuropäische[r]“ Künstler. Unanfechtbar nämlich sei, dass „Liszts wirkliche Gefühlssituation, sein Verhältnis zu seiner Umgebung nichts mit [Peter] Raabes romantischer Bohème-Heimatlosigkeit zu tun hat; was uns hier entgegentritt, ist vielmehr die ‚Wurzelhaftigkeit‘ und der Humanismus eines osteuropäischen Künstlers, der seine Heimat gesucht und im weitesten und bleibendsten Sinne des Wortes schließlich auch gefunden hat“.Bence Szabolcsi: Franz Liszts Lebensabend, in: MuG 6 (1956), 456–459, 457. Entsprechend ziehe sich auch der ungarische Stil wie ein roter Faden durch sein Schaffen.Bence Szabolcsi: Franz Liszts Lebensabend, in: MuG 6 (1956), 456 f.; beispielhaft genannt werden u. a. die Symphonischen Dichtungen Tasso und Heroïde funèbre, die h-Moll-Sonate sowie die Krönungsmesse.
Bemerkenswert ist, wie sich sogar das rätselhafte, oft als bruchstückhaft oder gar – psychologisierend – verzweifelt wahrgenommene Spätwerk in diese Erzählung von Liszt als im weitesten Sinne Sozialrevolutionär einfügen lässt. Kárpáti spricht diesbezüglich vage vom „erneute[n] revolutionäre[n] Experimentieren“: „Dies ist die letzte Revolution des alten Liszts [sic], die Revolution mit der größten Bedeutung, aber eine nur angefangene Revolution.“János Kárpáti: Das Erbe Franz Liszts und die ungarische Musikwissenschaft. Zum 145. Geburtstag und 70. Todestag des Meisters, leicht gekürzte Übersetzung von A. Czongár, in: MuG 6 (1956), 456. Auch Szabolsci betont, dass Liszt die Ideale der Revolution unvermindert bis an sein Lebensende hochgehalten habe – aufgrund der tatsächlichen, ernüchternden gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse seiner Gegenwart sei er aber eben daran verzweifelt.Bence Szabolcsi: Franz Liszts Lebensabend, in: MuG 6 (1956), 457.
1961 – Konsolidierung

Das Jubiläumsjahr 1961 war ein „erste[r] Höhepunkt der Liszt-Pflege“ in der DDRHans Rudolf Jung: Liszt-Pflege in der DDR, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), 113–126, 120. URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf. – und zugleich, so Wolfram Huschke, eine „Eintagsfliegen-Feier“.Wolfram Huschke: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010, 321. Weiter heißt es hier: „Dass 1961 anderswo – insbesondere mit und durch Alfred Brendel – eine neue Sicht und Entwicklung Raum gewann, kam in Weimar noch lange nicht an.“ (ebd.). In der Tat: Verglichen mit den Bach- oder Beethoven-Jubiläen fielen die Feierlichkeiten zu Liszts 150. Geburtstag bescheiden aus; aufschlussreich ist auch, dass Liszt in Georg Kneplers prominenter, zweibändiger Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, immerhin just in diesem Jahr (1961) in Ost-Berlin erschienen, im Gegensatz zu Hector Berlioz nur ganz am Rande vorkommt – und wenn er genannt wird, dann in einem Atemzug mit Frédéric Chopin.Georg Knepler: Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. 1: Frankreich – England, Berlin 1961, 255.
In Weimar fand im Oktober 1961 eine erneute Festwoche mit einer Ausstellung, Publikationen und Konzerten statt. Jene Rezeptionstopoi, die sich bereits fünf Jahre zuvor als zentral andeuteten, wurden nun auch von weiteren namhaften (linientreuen) Musikwissenschaftlern aufgegriffen. Hansjürgen Schaefer etwa hob am 2. August 1961 in der Parteizeitung Neues Deutschland Liszts „Bekenntnis zum revolutionären Erbe der Klassiker“ hervor. So seien auch Werke wie das „heroische“ erste Klavierkonzert von der „kämpferische[n] Parteinahme des Musikers für die freiheitlich-demokratischen Ideen“ von 1848 geprägt. Der Autor verweist außerdem auf einen vermeintlichen blinden Fleck des Komponisten, denn der „bürgerliche Demokrat Liszt“ habe „die gesellschaftlichen Widersprüche seiner Zeit“ vor allem nach 1848 nicht durchschaut und sei so in seinen späteren Jahren „aus der Misere der Realität in die mystischen Sphären religiöser Ideale“ geflüchtet.Hansjürgen Schaefer: … in die Weiten der Zukunft. Franz Liszt zum 75. Todestag am 31. Juli, in: Neues Deutschland, Berliner Ausgabe, 16. Jg., Nr. 211 vom 2. 8. 1961, 4. Eine solche Einschätzung war in der DDR nicht unbedingt Konsens; zumeist ging man, wie schon fünf Jahre zuvor, davon aus, dass Liszt bis zum Schluss ein „Kind des bürgerlich-revolutionären Aufschwunges von 1830 bis 1848“ gewesen sei und dass sein „Bewußtsein der Vereinsamung, der Isolierung“ der späteren Jahre umso stärker gewesen sei.Werner Felix: Franz Liszt: Ein Lebensbild, 2. Aufl. Leipzig 1961, 198.
Die Deutung schwankt also zwischen irrationaler Zuflucht beim Mystizismus und rational erklärbarer politischer Resignation. In einer in Musik und Gesellschaft veröffentlichten musikalischen Analyse der späten Klavierstücke Ungarische Bildnisse, komponiert wahrscheinlich 1885, spricht der ungarische Musikkritiker und Musikwissenschaftler György Kroó in diesem Sinne von „dunkle[m] Kummer, Qual, Ringen ohne Erlösung“, von unverhülltem „Seelenschmerz“ und „düstere[n] Tragödien“: „Der Monolog der Einsamkeit wird durch starr, hartnäckig wiederholte Grundthemen, durch den Ostinato-Charakter, fast bis zur Unerträglichkeit gespannt“.György Kroó: Franz Liszts „Ungarische Bildnisse“, in: MuG 11 (1961), 599–603, 602. Die politischen Ereignisse nach der missglückten Revolution habe der Komponist als „seinem persönlichen Schicksal verwandt“ empfunden: „Liszt empfand in den letzten Lebensjahren die tragische Bitternis des Künstlers, des Menschen und des Patrioten mit gleicher Intensität.“György Kroó: Franz Liszts „Ungarische Bildnisse“, in: MuG 11 (1961), 599–603, 603.
Oder, anders gewendet: Das Private (hier: eines Künstlers) ist politisch. Und da aus dieser Perspektive das Private zugleich die Kunst bestimmt, ist auch das Künstlerische politisch.
Neu ist außerdem, dass man sich 1961, im Jahr des Mauerbaus, deutlicher als zuvor, nun auch unter Rückgriff auf das musikalische Erbe, von Westdeutschland abzugrenzen suchte. Luitpold Steidle, Weimarer Oberbürgermeister und Vorsitzender des damaligen Liszt-Festkomitees in der DDR, plädierte in der unionsnahen Tageszeitung Neue Zeit am 15. Oktober 1961 – eine Woche vor Liszts 150. Geburtstag – für nichts weniger als ein notwendiges neues Liszt-Bild, das sich von der „bürgerlich-idealistische[n]“ Forschung konsequent abzugrenzen habe. Vor allem in Westdeutschland nämlich werde der Komponist „von einer unbelehrbaren, eigensüchtigen deutschen Geschichtsforschung als deutschstämmiger Abkömmling, genau wie in der Zeit der faschistischen Herrschaft, […] ‚vereinnahmt‘“.Luitpold Steidle: Franz Liszt und unsere Zeit, in: Neue Zeit, Berliner Ausgabe, 17. Jg., Nr. 242 vom 15. 10. 1961, 1 f.
Westdeutsch-‚reaktionäre‘ Ansätze dieser Art, entweder der (vermeintlichen) Germanisierung des Komponisten oder der Identifikation Liszts als Kosmopoliten, gingen demzufolge, so Felix, Hand in Hand mit der Tendenz, Liszts Verankerung in revolutionären Umbruchszeiten und dessen „fortschrittliche Position“ zu leugnen; dies sei „unzweifelhaft ein ernstes Problem der bisherigen Lisztforschung“.Werner Felix: Liszts Schaffen um 1848: Versuch zur Deutung seiner Programmatik, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae: Bericht über die Zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt, Bartók (Budapest, 1961), Fasc. 1/4, T. 5 (1963), 59–67, 59 f. In seiner Liszt-Biographie von 1961 heißt es außerdem: „So gilt heute die Frage der Anerkennung von Liszts Zugehörigkeit zur ungarischen Nation als Gradmesser dafür, von welcher politischen Plattform aus dieser Künstler gesehen wird.“ (209). (Damit ist sicherlich auch die westdeutsche Fokussierung auf das ‚Musikalisch-Stilistische‘ gemeint, das – wie auch im Falle Beethovens und anderer Komponisten – von Gesellschaftlichem absehen zu können glaubte.) Der Budapester Musikwissenschaftler Kálmán Czomacz Tóth zeigte sich entsprechend erleichtert darüber, dass insbesondere die DDR-Musikwissenschaft sich von der vermeintlichen deutsch-nationalen Vereinnahmung Liszts konsequent distanziert habe.Kálmán Czomacz Tóth: Virtuose, Weltmann, genialer Komponist. Zum 150. Geburtstag von Franz Liszt, in: Neue Zeit, Berliner Ausgabe, 17. Jg., Nr. 248 vom 22. 10. 1961, 4. Auch die Weimarer Festwoche wurde allerorten gelobt; noch einmal Hansjürgen Schaefer im Neuen Deutschland, diesmal kurz nach dem 150. Jahrestag: Man habe sich in Weimar überzeugen können, „wie viele“ von Liszts „weit vorausschauenden Ideen und Pläne[n] hier“ – im „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ – „Wirklichkeit geworden sind“.Hansjürgen Schaefer: Festwoche in Weimar. Die Deutsche Demokratische Republik ehrte Franz Liszt zu seinem 150. Geburtstag, in: Neues Deutschland, Berliner Ausgabe, 16. Jg., Nr. 299 vom 30. 10. 1961, 3.
Zu jenen Kompositionen, die im Liszt-Jahr 1961 zu besonderen Ehren kamen und immer wieder als fortschrittlich hervorgehoben wurden, zählen, neben Lyon und dem ebenfalls bereits erwähnten Arbeiterchor, u. a. die Symphonische Dichtung Les Préludes, eine Musik, so Felix, „voller Kraft und stürmischem Elan“,Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 591. die „zu den historischen Ereignissen der Revolutionszeit in einer engen gedanklichen und emotionalen Beziehung“ steht.Werner Felix: Liszts Schaffen um 1848: Versuch zur Deutung seiner Programmatik, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae: Bericht über die Zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt, Bartók (Budapest, 1961), Fasc. 1/4, T. 5 (1963), 59–67, 62 f.; „Wir tun deshalb recht daran, ein solches Werk aus der intimen, privaten Sphäre herauszulösen und in die erregenden Zusammenhänge der Zeit seiner Entstehung einzuordnen. Die Musik dieses Werkes zeigt den Komponisten auf einem Höhepunkt seiner schöpferischen Aktivität. Diese Aktivität zog aber ihre Nahrung aus dem vorwärtsdrängenden Geist der revolutionären Bewegung.“ Vgl. dazu Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 49: „If classical humanism was deemed to offer a historical precedent for the enlightened socialist self, the romantics embodied the attributes of the Western other.“ Zugleich müsse jenem Werk „auch die letzte Spur jener unerhörten Schändung genommen“ werden, „die ihr in der Zeit des barbarischen Hitlerkrieges zugefügt worden ist“.Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 591. Das Hauptthema von Les Préludes wurde im Zweiten Weltkrieg als Erkennungsmelodie für den Wehrmachtbericht im Rundfunk und in den Wochenschauen verwendet. Angeführt werden auch die beiden Klavierkonzerte sowie der Totentanz, Werke, in denen die Virtuosität – so Werner Felix – ein neues „Denken und Erleben“ verkörpere. Die Frage ist suggestiv: „Wer wollte heute noch im Ernst behaupten, daß diese Werke mit dem Geschehen und dem Geist der Revolution nichts zu tun hätten?“Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 591.
In der Symphonischen Dichtung Hungaria wiederum (1854), so Felix – und diese Deutung ist mit Blick auf ein derart explizit programmatisches Werk sicherlich schlüssiger, wenn auch angesichts der Metaphorik fragwürdig –, herrschten „männlich kraf[t]volle, kämpferische Züge vor“;Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 591. es handele sich um „nichts anderes als ein neues Bekenntnis zu den Ideen, die in Ungarn auf den Fahnen der Revolutionäre gestanden hatten“.Werner Felix: Liszts Schaffen um 1848: Versuch zur Deutung seiner Programmatik, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae: Bericht über die Zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt, Bartók (Budapest, 1961), Fasc. 1/4, T. 5 (1963), 59–67, 63. Generell sei Liszts Musik „tief innerlich von einer starken Bindung an die Errungenschaften der musikalischen Klassik getragen“. Entsprechend – und das ist entscheidend – sei es verfehlt, den Komponisten „als Kronzeuge[n] für die Rechtfertigung eines verschwommenen Romantikbegriffes“ zu benutzen, denn Liszt habe nie dem „Typ des sogenannten romantischen Künstlers“ entsprochen.Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 592.
Auch Liszts Virtuosität sei niemals Selbstzweck, sondern habe ihre Ursache in einem veränderten Wirklichkeitserleben – und damit letztlich in tiefgreifenden gesellschaftlichen Prozessen. Diese werden zwar nicht explizit benannt; gemeint sind aber die Industrialisierung und das sich neu formierende Selbstbewusstsein von Proletariern und Arbeitern, das sich auch in der Virtuosität bemerkbar mache. Auch in dieser Hinsicht ist der Künstler also ein Seismograph. Die Widersprüche in Liszts Leben und Werk seien demnach nichts anderes als eine (hier: unbewusste) Widerspiegelung der „ungelösten Widersprüche im Leben der Gesellschaft“;Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 595. gemeint sind die Klassengegensätze. Als Fazit hält Felix fest: „Viele der kühnen, vorwärtsweisenden Ideen, die Franz Liszt vor hundert Jahren aussprach oder niederschrieb, gehen erst heute im Zeichen des Sozialismus in Erfüllung. Auf diese Weise ist die sozialistische Gesellschaft […] zum eigentlichen Vollstrecker seiner großartigen Gedanken und Pläne geworden.“Werner Felix: Franz Liszt: Ein Lebensbild, 2. Aufl. Leipzig 1961, 214.
1986 – Revision und Öffnung
Was Wolfram Huschke mit Blick auf die Zeit zwischen den frühen 1960er- und den späten 1970er-Jahren für die Weimarer Hochschule konstatierte, lässt sich ohne weiteres auf die gesamte DDR übertragen: Liszt war in dieser Zeit, jenseits einzelner Konzerte und einiger repräsentativer Anlässe vor ausländischen Gästen, nahezu vergessen.Wolfram Huschke: Zur Liszt-Identität der Musikhochschule Weimar, in: Franz Liszt and Advanced Musical Education in Europe: International Conference (= Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae T. 42, Fasc. 1/2 (2001)), 197–212, 208; s. auch Wolfram Huschke: Nachwirkung in Konzertpraxis und Forschung. Liszt-Pflege in Weimar heute, in: MuG 36 (1986), 350–351, 350. Auch 2010 konstatiert Huschke, hier vor allem mit Blick auf Weimar: „In den folgenden zwei Jahrzehnten [nach 1961] geschah auf Liszt bezogen nicht viel. Die künstlerische und wissenschaftliche Selbstdarstellung der Hochschule zu ihrer Hundertjahrfeier 1972 war eher blamabel. Liszt kam hier so vor, dass der Gesamteindruck eher verstärkt als verwischt wurde, die Hochschule habe ihn inzwischen jenseits von Briefkopf und einer neuen und durchaus hässlichen Liszt-Medaille fast vergessen, als eine alte Gewohnheit, die man lieber nicht reflektiert.“ Wolfram Huschke: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010, 322. Im Gegensatz zu Bach, Händel, Beethoven oder Wagner spielte er für das eigene Selbstverständnis kaum eine Rolle. Nach einem erfolglosen ersten Gründungsversuch einer Weimarer Liszt-Gesellschaft rief der vormalige Rektor der Hochschule, Hans-Rudolf Jung, 1982 einen „Arbeitskreis Franz Liszt“ (später geleitet von Wolfgang Marggraf bzw. Wolfram Huschke) ins Leben, der 1990 in die heute immer noch existierende Franz-Liszt-Gesellschaft überging. Dem „insgesamt nicht befriedigenden Stand der Liszt-Pflege in Weimar und in der DDR“Hans Rudolf Jung: Liszt-Pflege in der DDR, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), 113–126, 120. URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf. sollte damit produktiv begegnet werden. Seit 1983 fanden alljährlich im Oktober die Weimarer Liszt-Tage statt, der Liszt-Klavierwettbewerb zog seit 1986 ein interessiertes Publikum an. Und eben jener Arbeitskreis Franz Liszt war es auch, der für die Liszt-Feierlichkeiten 1986 – der Todestag des Meisters jährte sich am 31. Juli zum 100. Male – verantwortlich zeichnete.
Das Jahr 1986 war bereits von einem Hauch Glasnost und Perestroika geprägt; dies war auch im Bereich der Kultur und Musik zu spüren. Der Rekurs auf Liszt als Kämpfer für die revolutionäre Arbeiterklasse hielt sich nunmehr entsprechend in sehr engen Grenzen. Auffallend hingegen ist, wie sehr man bemüht war, ein Liszt-Bild in all seinen Widersprüchen zu zeichnen, wobei auch Liszts Kirchenmusik im Oktober 1986 im Rahmen eines Weimarer Symposiums, veranstaltet durch den Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen, wieder verstärkt in den Fokus rückte.Vgl. Wolfgang Hanke: Neubewertung eines Lebenswerkes. Zum Symposion „Franz Liszt und die Kirchenmusik“ in Weimar, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 275 vom 21. 11. 1986, 7. In diesem Jahr erfuhr zudem die von dem Weimarer Organisten Michael von Hintzenstern wenige Jahre zuvor wiederentdeckte „Liszt-Orgel“ in Denstedt einige Aufmerksamkeit.Michael von Hintzenstern: Wo einst auch Liszt musizierte. Im Originalzustand erhalten: die Peternellorgel in Denstedt bei Weimar, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 157 vom 5. 7. 1986, 4. Hintzenstern war es auch, der sich für das kirchenmusikalische und Orgelschaffen Liszts praktisch wie auch publizistisch engagierte.Vgl. u. a. Michael von Hintzenstern: Zum 100. Todestag von Franz Liszt. „Zukunftsmusik“ der späten Jahre für den sakralen Raum, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 179 vom 31. 7. 1986, 4.
Neben der Kirchenmusik war es vor allem das ‚Spätwerk‘, das nun das verstärkte Interesse auch der Wissenschaft auf sich zogEin Faktor für dieses Interesse könnte u. a. das Erscheinen von Diether de la Mottes Harmonielehre in der DDR 1977 (als Lizenzausgabe) sein: Der Autor widmet in diesem auch in Ostdeutschland intensiv rezipierten Buch Liszts Harmonik ein eigenes Kapitel und geht dabei u. a. auf Drei späte Klavierstücke, auf La lugubre gondola sowie auf die Bagatelle ohne Tonart ein. – ein Spätwerk offensichtlich, das sich nicht mehr erschöpfend aus dem bloßen Scheitern utopisch-revolutionärer Ideale erklären lässt. Der Weimarer Musikwissenschaftler Wolfgang Marggraf etwa widmete sich in seinem zentralen Beitrag zum Jubiläumsjahr 1986, publiziert in Musik und Gesellschaft, fast ausschließlich dem späten ‚Zukunftsmusiker‘ der 1880er Jahre. Die Ambivalenzen Liszts zwischen sozialem Engagement und aristokratischer Lebensführung nicht aus dem Auge verlierend, heißt es angesichts des ebenso rätselhaften wie bestürzenden, erschütternden und hoffnungslosen, ja: radikalen Spätwerks, das sich „auch den letzten Konzessionen an Hörgewohnheiten“ verweigere, dass dieses „Kundgaben eines Gescheiterten, Gebrochenen“ beinhalte, „der die Epochenproblematik auf seine Weise erleidet“. Dies alles sei allein „aus persönlichen Motiven“ nicht erklärbar: „In der Trauer, die diese Kompositionen beherrscht, hat sich […] vor allem die leidvolle Einsicht in das Ende aller utopischen Hoffnungen niedergeschlagen, mit denen die Generation Liszts ihren Weg durch die Geschichte begann.“ Es folgt ein für das Verhältnis der späten DDR zum späten Liszt zentraler Satz: Diese Erfahrung führe bei Liszt – „ungleich radikaler“ noch als bei Wagner – „zum Verfall der Werkidee selbst“. Es handele sich um ein „Zeugnis kompromißloser Aufrichtigkeit, die jedes wie immer geartete Werk als Versuch scheinhafter Affirmation empfindet und darum von ihm [dem ‚Werk‘] sich distanziert“.Wolfgang Marggraf: „… den Speer in den unendlichen Raum der Zukunft schleudern“. Traditionsbezüge und Innovationen im Schaffen Franz Liszts, in: MuG 36 (1986), 342–347, 346. Der „Werkbegriff, eine zentrale Kategorie der klassischen Ästhetik“, sei „auf diese Kunstgebilde nur noch bedingt anwendbar“.Wolfgang Marggraf: „… den Speer in den unendlichen Raum der Zukunft schleudern“. Traditionsbezüge und Innovationen im Schaffen Franz Liszts, in: MuG 36 (1986), 342–347. Spätestens hier fragt man sich, wer hier eigentlich schreibt – der 2023 verstorbene Weimarer Musikwissenschaftler Wolfgang Marggraf oder der Frankfurter Musikphilosoph Theodor W. Adorno? – Marggraf geht so weit, den „Zerfall der Werkidee im Spätschaffen Liszts“ als (im Superlativ) „extremste [!] Ausprägung einer Tendenz“ zu begreifen, „die letztlich sein gesamtes Komponieren bestimmte“. Und just hier setze das Vermächtnis des Künstlers ein, an das es anzuknüpfen gelte: Dieser Speer, den Liszt weit in den Raum der Zukunft geschleudert hatte, müsse nun aufgehoben werden.Wolfgang Marggraf: „… den Speer in den unendlichen Raum der Zukunft schleudern“. Traditionsbezüge und Innovationen im Schaffen Franz Liszts, in: MuG 36 (1986), 342–347, 347.
In ihrem 2014 veröffentlichten Buch über Romantikrezeption in der DDR (Composing the Canon) vertritt Elaine Kelly die originelle These, dass Adornos Konzeption des ‚Spätwerks‘ (gemeint ist vor allem dasjenige Beethovens) in der späten DDR greifbare Realität geworden sei: Ähnlich wie bei Adornos Beethoven sei es demnach auch in der DDR vor allem die Ironie, als künstlerisches Mittel der Distanzierung, die in einem fragmentierten sozialistischen Kollektiv eine Renaissance erlebt habe.Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 22: „And as with Adorno’s model of lateness in art, the fragmentation of the socialist collective resulted in a climate in which irony flourished.“ Auf dem Gebiet der Musik kann man sich diesbezüglich u. a. mit Blick auf Kompositionen von Reiner Bredemeyer, Friedrich Schenker oder Christfried Schmidt überzeugen. Ironie ist zugleich eine zutiefst romantische Errungenschaft.
Auch Peter Gülke zeigt sich 1987 fasziniert ausgerechnet von Liszts Spätwerk. Beim dortigen Verzicht auf jegliche (musikalisch-kompositorische) Inszenierung, sonst für Liszt charakteristisch, die nunmehr, da ohne Adressat, sinnlos geworden sei, handele es sich um nichts weniger als um die, so Gülke, „Abdankung des Kunstcharakters“.Peter Gülke: Über Liszts „inszenatorisches“ Komponieren, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), Bd. 78, 16–28, 27, URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf. Eine derartige Interpretation ist noch radikaler als der Verweis auf den lediglich aufgehobenen Werkbegriff – denn Kunst geht damit direkt über ins Leben, die Utopie hebt sich auf. Während Marggraf also (im Sinne Adornos) auf eine Ästhetik der Moderne verweist, geht Gülke, mit Liszt, implizit den Schritt hin zur Avantgarde, zur – so die bekannte Formel von Peter Bürger – „Rückführung der Kunst in die Lebenspraxis“.Peter Bürger: Theorie der Avantgarde, Frankfurt a. M. 1984, 98. Im Gegensatz zum Liszt des Jahres 1961 war jener von 1986 wiederum – und das hängt mit dem ‚Spätwerk-Charakter‘ der späten DDR zusammen – vor allem heimatlos. Gülke konstatierte, „daß er nirgends hingehörte, nirgends ganz dazugehörte und noch als magyarischer Nationalheros Gast blieb“: „Ungar mit heißem Herzen, aber zugleich einer ganz nach dem Bilde, das man sich z. B. in Pariser Salons von einem Ungarn machte“.Peter Gülke: Über Liszts „inszenatorisches“ Komponieren, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), Bd. 78, 16–28, 27, URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf.
Seit den frühen 1980er-Jahren wurde in der DDR die Romantik rehabilitiert: 1981 fand in Dresden eine Romantik-Konferenz statt, 1984 widmete Musik und Gesellschaft dem Thema ein Sonderheft. Auch die Liszt-Rezeption geriet in dieses Fahrwasser, wobei, mehr noch als in der BRD, ‚Romantik‘ (und damit auch der ‚Romantiker‘ Liszt) einen dezidiert politischen Impuls be- bzw. erhielt: Neben Marggraf und Gülke ist auch Frank Schneider in seinem Liszt-Porträt von 1988 vom Spätwerk des höchst widerspruchsvollen Komponisten fasziniert. Der Kosmopolit und Patriot, „weitherzige und mildtätige Demokrat“, „heillose […] Egozentriker“, „zeitweilig radikale Sozialist“ und Aristokratenfreund, Bonvivant und Asket, Denker und KatholikFrank Schneider: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162, 150. habe, so Schneider, mit seinen späten Klavierstücken – und hier bezieht er sich explizit auf die Nr. 4, „László Teleki“, aus den Historischen Ungarischen Bildnissen – eine „absolut querständige Musik“ geschaffen, „die mit ihrer experimentellen, fast schon atonalen Harmonik, mit ihrer strikt daraus konstruierten motivischen Konsequenz und ihrer beinahe skeletthaften pianistischen Kargheit unmittelbar zur Vorgeschichte der neuen Musik unseres Jahrhunderts gehört“.Frank Schneider: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162, 145. Mit dieser Deutung knüpfte Schneider nicht zuletzt an seinen westdeutschen Kollegen Carl Dahlhaus an, der die strukturelle Avanciertheit in Liszts Kompositionen als explizit moderne Errungenschaft analysierte, etwa in der Symphonischen Dichtung Prometheus.

László Teleki ist der Name eines an der 1848er-Revolution beteiligten, dann aber verhafteten und schließlich begnadigten ungarischen Freiheitskämpfers, der sich am Ende aus Gewissensgründen das Leben nahm. Liszt verwendet in dieser Komposition standardisierte „Marsch-, Gebets- oder Signal-Intonationen“ (mit Tremoli-Trommeln in der linken Hand), laut Schneider „ein symbolischer Verweis auf die kollektive Biographie all jener […], die an den patriotischen Kämpfen um nationale Unabhängigkeit beteiligt waren“.Frank Schneider: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162, 148. Zweifellos hat das Stück mit der offiziellen, aber kaum bestätigten Tonart g-Moll eine auch semantisch nachvollziehbare Dramaturgie, ganz grob: Dem A-Teil mit einem charakteristischen, über ganze 56 Takte in der linken Hand hartnäckig wiederholten, Schritt für Schritt verdichteten Ostinato-Motiv fis–g–b–cis’ (in verschiedenen Oktaven; der Tritonus g–cis’ sticht auch durch die betonten Zählzeiten hervor) schließt sich nach einem kurzen, überleitenden Sostenuto-Teil ein gebetsartiger Mittelteil an. Obwohl dieser Abschnitt einen ganz anderen Charakter hat, ist auch hier das Ostinato-Motiv versteckt: zunächst kaum hör- und sichtbar, dann immer deutlicher, sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen. Ähnlich wie im Prometheus macht sich hier Liszts ‚strukturelles‘ Denken bemerkbar. Abschließend leitet das Motiv über in eine Art Verklärung – hier ist das Motiv gleichsam aufgehoben. Frank Schneider zufolge weist das Stück auch in semantischer Hinsicht eine klare Dramaturgie auf: „Vorerst isolierte Ereignisse treten zusammen, formieren sich wie zu einem Kondukt, steigern sich zum grandiosen Salut, schlagen um in andächtiges Gebet und münden in das Zeremoniell einer stolzen Totenbeschwörung“.Frank Schneider: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162, 145. Demnach handelt es sich um eine Art Miniatur-Heldenepos.
Parallelen zum Klavierstück Unstern! von 1881 sind kaum zu übersehen: Auch diese Komposition beginnt einstimmig-karg, skelettartig; auch hier gibt es an prominenter Stelle einen Tritonus sowie eine schrittweise Beschleunigung; die ebenfalls hörbaren Grenzen der Tonalität sind hier durch die bevorzugte Verwendung einer Ganztonskala markiert. Im späteren Verlauf der Komposition tauchen zudem, wie in „László Teleki“, Tremoli auf, dazu sind fast schon Cluster-artige Akkorde zu hören; am Ende mündet dies in eine Art Choral (sostenuto – quasi Organo). Der Schluss ist denkbar offen.
***
Zweifellos wurde Liszt in den 1980er-Jahren den offiziellen Kulturinstanzen, den Vertretern des Sozialistischen Realismus auch auf dem Gebiet der Musik entzogen und zum Vorläufer der Avantgarden – sicherlich auch jenen des eigenen Landes – gemacht. Dabei kam das Spätwerk gerade recht; Analoges lässt sich bereits anlässlich des Beethoven-Jubiläums 1970 feststellen, als sich Harry Goldschmidt im Gegensatz zu den üblichen Huldigungen des ‚mittleren‘ symphonischen, menschheitsverbrüdernden Beethoven in dessen Spätwerk vertiefte und damit zugleich ein Statement zur Kulturpolitik des eigenen Landes abgab.
An der Liszt-Rezeption in der DDR um das Jubiläumsjahr 1986 herum lässt sich zeigen, dass es vor allem darum ging, erneut, insbesondere auch im Ästhetischen, einen offenen Raum herzustellen, der die Zugänge zu Neuem und Anderem freilegt – immer auch in bestimmter Negation der offiziellen Liszt-Rezeption ein Vierteljahrhundert zuvor. Der ‚eutopische‘ (klassisch-revolutionäre) Liszt der frühen DDR wurde also zum ‚utopischen‘ (romantisch-avantgardistischen) der späten; das revolutionäre Potential des Künstlers verlagerte sich zugleich vom ‚Außermusikalischen‘ hinein in die Musik selbst.
Wer oder was war aber nun Liszt – jener von 1956 bzw. 1961 oder jener von 1986? Der westdeutsche oder der ostdeutsche, oder ein ganz anderer? – Zweifellos ist in Liszt all das enthalten, was in den 30 Jahren von 1956 bis 1986 (wie auch davor und danach) als Facette des Menschen und Künstlers jeweils in den Vordergrund gerückt wurde. Nicht zuletzt der Liszt-Rezeption in der DDR ist es zu verdanken, dass Liszt auch als politisch denkender und schaffender Künstler angemessen ins Blickfeld der Musikwissenschaft rückte. Rezeptionsgeschichte erhellt somit immer mindestens zweierlei: die Anliegen, Wünsche und Ziele der Rezipienten (hier: der Menschen in der DDR, entweder geprägt vom sozialistischen Aufbauwillen oder desillusioniert vom eigenen Staat) wie des Rezeptionsobjekts (hier: Liszt). Die Rezeption ist Teil des Gesamtphänomens, und man wird einer historischen Figur nicht vollständig gerecht, wenn man diesen Faktor ausblendet. Liszt ist auch ein Diskurs, zu Lebzeiten schon, bis heute.
Eine entscheidende Facette der Liszt-Rezeption in der DDR wurde in diesem Beitrag ausgespart – und das ist die künstlerische. Tatsächlich war die Beziehung zwischen wissenschaftlich-theoretischem Diskurs und künstlerischer Praxis auch in der DDR oft, wie es Elaine Kelly ausdrückte, „less than harmonious“;Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 4: „[T]he relationship between discourse and practice in the GDR was often less than harmonious.“ so legte etwa ein so umtriebiger Pianist wie der ehemalige Rektor der Weimarer Hochschule, Bruno Hinze-Reinhold, seinen Fokus auf Liszts Spätwerk, lange bevor dies die Wissenschaft tat: „Zu meiner Aufgabe als Interpret ist es geworden, nach dem Wertbeständigen und Zukunftsweisenden in seinem [Liszts] Schaffen zu suchen“, heißt es in den Lebenserinnerungen des Pianisten.Bruno Hinze-Reinhold: Lebenserinnerungen, hg. von Michael Berg, Weimar 1997, 192. In einem 1961 in der Thüringischen Landeszeitung publizierten Artikel („So jung war der alte Liszt!“) heißt es bei Hinze-Reinhold: „Was nun Liszt als selbständigen Tonschöpfer anlangt, so ist es nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt, daß er eigentlich den Unterbau geschaffen hat, auf welchem die ganze neuere Musik steht.“ Demnach sind bei Liszt bereits „schon ganze Blütenknospen“ des Impressionismus nachweisbar; „[s]elbst im Sinne der Zwölftonmusik aufgestellte Themen lassen sich bei ihm nachweisen. In vielen Alterswerken kümmert sich der Komponist überhaupt nicht mehr um harmonische Gesetze. Dieser Expressionismus ist in fast allen Fantasiestücken und Monologen der letzten Lebensjahre zu verspüren. Das Motivische – es sind meist aneinandergereihte Motivfetzen ohne eigentliche Durcharbeitung – ist hochinteressant. Vieles ziemlich gewagt und ungehemmt. Die Härte seiner Tonsprache und die gewisse Atonalität gemahnen geradezu an Hindemith und Bartók […]. In seinen Schlüssen weicht der Meister gänzlich vom Normalen ab und endet kaum mehr wohlgesittet auf der Tonika, sondern irgendwo im Wesenlosen.“ Zit. nach ebd., 194 f. Die entsprechenden Interpretationen des Liszt’schen Spätwerks lassen sich auf der erwähnten Tondokumente-Seite der Hochschule für Musik nachvollziehen – die Interpretationsgeschichte des Liszt’schen Werks böte sicherlich genug Stoff für eine eigene Untersuchung.
Gedruckte Quellen und Literatur
[Anonym] (–er.–): Franz-Liszt-Hochschule zu Weimar, in: MuG 6 (1956), 458.
Felix, Werner: Franz Liszt: Ein Lebensbild, 2. Aufl. Leipzig 1961.
Felix, Werner: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596.
Felix, Werner: Liszts Schaffen um 1848: Versuch zur Deutung seiner Programmatik, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae: Bericht über die Zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt, Bartók (Budapest, 1961), Fasc. 1/4, T. 5 (1963), 59–67.
Gülke, Peter: Über Liszts „inszenatorisches“ Komponieren, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Bd. 78, (1987), 16–28, 27, URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf (8. 7. 2025).
Hanke, Wolfgang: Neubewertung eines Lebenswerkes. Zum Symposion „Franz Liszt und die Kirchenmusik“ in Weimar, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 275 vom 21. 11. 1986, 7.
Hintzenstern, Michael von: Wo einst auch Liszt musizierte. Im Originalzustand erhalten: die Peternellorgel in Denstedt bei Weimar, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 157 vom 5. 7. 1986, 4.
Hintzenstern, Michael von: Zum 100. Todestag von Franz Liszt. „Zukunftsmusik“ der späten Jahre für den sakralen Raum, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 179 vom 31. 7. 1986, 4.
Hinze-Reinhold, Bruno: Lebenserinnerungen, hg. von Michael Berg, Weimar 1997.
Hoffmann, Antje: Bruno Hinze-Reinhold – der letzte Bewahrer der Liszt-Tradition in Weimar nach 1945? Masterarbeit (unveröff.), Weimar 2015. → pdf-Datei
Huschke, Wolfram: Nachwirkung in Konzertpraxis und Forschung. Liszt-Pflege in Weimar heute, in: MuG 36 (1986), 350–351.
Huschke, Wolfram: Zur Liszt-Identität der Musikhochschule Weimar, in: Franz Liszt and Advanced Musical Education in Europe: International Conference (= Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae T. 42, Fasc. 1/2 (2001)), 197–212.
Huschke, Wolfram: Zukunft Musik: eine Geschichte der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, Köln u. a. 2006.
Huschke, Wolfram: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010.
Jung, Hans Rudolf: Liszt-Pflege in der DDR, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), 113–126, 120. URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf (8. 7. 2025).
Kárpáti, János: Das Erbe Franz Liszts und die ungarische Musikwissenschaft. Zum 145. Geburtstag und 70. Todestag des Meisters, leicht gekürzte Übersetzung von A. Czongár, in: MuG 6 (1956), 453–256.
Kelly, Elaine: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014.
Knepler, Georg: Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. 1: Frankreich – England, Berlin 1961.
Kroó, György: Franz Liszts „Ungarische Bildnisse“, in: MuG 11 (1961), 599–603.
Marggraf, Wolfgang: „… den Speer in den unendlichen Raum der Zukunft schleudern“. Traditionsbezüge und Innovationen im Schaffen Franz Liszts, in: MuG 36 (1986), 342–347.
Schaefer, Hansjürgen: … in die Weiten der Zukunft. Franz Liszt zum 75. Todestag am 31. Juli, in: Neues Deutschland, Berliner Ausgabe, 16. Jg., Nr. 211 vom 2. 8. 1961.
Schaefer, Hansjürgen: Festwoche in Weimar. Die Deutsche Demokratische Republik ehrte Franz Liszt zu seinem 150. Geburtstag, in: Neues Deutschland, Berliner Ausgabe, 16. Jg., Nr. 299 vom 30. 10. 1961, 3.
Schneider, Frank: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162.
Steidle, Luitpold: Franz Liszt und unsere Zeit, in: Neue Zeit, Berliner Ausgabe, 17. Jg., Nr. 242 vom 15. 10. 1961, 1 f.
Szabolcsi, Bence: Franz Liszts Lebensabend, in: MuG 6 (1956), 456–459.
Tóth, Kálmán Czomacz: Virtuose, Weltmann, genialer Komponist. Zum 150. Geburtstag von Franz Liszt, in: Neue Zeit, Berliner Ausgabe, 17. Jg., Nr. 248 vom 22. 10. 1961, 4.
Anmerkungen
- Zu dieser Ambivalenz s. Thomas Lindenberger (Hg.): Herrschaft und Eigen-Sinn in der Diktatur. Studien zur Gesellschaftsgeschichte der DDR, Köln u. a. 1999.
- Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 143.
- Wolfram Huschke: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010, 318.
- Werner Felix: Franz Liszt: Ein Lebensbild, 2. Aufl. Leipzig 1961. Wolfram Huschke kommentiert: „Mangels anderer solcher Arbeiten wurde sie zum nächsten Jubiläum 1986 noch einmal aufgelegt. Weitaus geschickter als in der Festschrift von 1956 beleuchtet Felix hier die historisch vielfältigen Aspekte im scharfen Licht der damaligen kulturpolitischen Doktrinen, ohne dem Gegenstand allzu viel Gewalt anzutun.“ Wolfram Huschke: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010, 320.
- Vor allem für die ungarische Delegation war die Weimarer Reise mit einigen Komplikationen verbunden, da just einen Tag später, am 23. Oktober, ein landesweiter Volksaufstand gegen das ungarische Regime in Budapest blutig niedergeschlagen wurde, so dass man zunächst nicht ins Heimatland zurückkehren konnte.
- https://www.hfm-weimar.de/tondokumente/die-verleihung-des-namens-franz-liszt-an-die-hochschule-im-jahre-1956 (Ansprache von Hans Pischner, ca. 14′05″ bis 15′30″).
- Zur ‚Eutopie‘ in der DDR vgl. auch Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 148.
- Wolfram Huschke: Zukunft Musik. Eine Geschichte der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Köln u. a. 2006, 390 f.
- Wolfram Huschke: Zukunft Musik. Eine Geschichte der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Köln u. a. 2006, 390 f.
- [Anonym] (–er.–): Franz-Liszt-Hochschule zu Weimar, in: MuG 6 (1956), 458. Die Karl Marx’sche Nomenklatur, „utopischer Sozialismus“ statt „Frühsozialismus“, wird in der DDR durchgehend übernommen.
- János Kárpáti: Das Erbe Franz Liszts und die ungarische Musikwissenschaft. Zum 145. Geburtstag und 70. Todestag des Meisters, leicht gekürzte Übersetzung von A. Czongár, in: MuG 6 (1956), 453–256, 456. Zuvor heißt es: „Es kann kein Zufall sein, daß wir, indem wir nach dem Ungar Liszt suchten, bei dem Revolutionär Liszt angelangt sind. Dies ist kein ‚falscher Kreis‘ […]“ (ebd.).
- János Kárpáti: Das Erbe Franz Liszts und die ungarische Musikwissenschaft. Zum 145. Geburtstag und 70. Todestag des Meisters, leicht gekürzte Übersetzung von A. Czongár, in: MuG 6 (1956), 455.
- Bence Szabolcsi: Franz Liszts Lebensabend, in: MuG 6 (1956), 456–459, 457.
- Bence Szabolcsi: Franz Liszts Lebensabend, in: MuG 6 (1956), 456 f.; beispielhaft genannt werden u. a. die Symphonischen Dichtungen Tasso und Heroïde funèbre, die h-Moll-Sonate sowie die Krönungsmesse.
- János Kárpáti: Das Erbe Franz Liszts und die ungarische Musikwissenschaft. Zum 145. Geburtstag und 70. Todestag des Meisters, leicht gekürzte Übersetzung von A. Czongár, in: MuG 6 (1956), 456.
- Bence Szabolcsi: Franz Liszts Lebensabend, in: MuG 6 (1956), 457.
- Hans Rudolf Jung: Liszt-Pflege in der DDR, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), 113–126, 120. URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf.
- Wolfram Huschke: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010, 321. Weiter heißt es hier: „Dass 1961 anderswo – insbesondere mit und durch Alfred Brendel – eine neue Sicht und Entwicklung Raum gewann, kam in Weimar noch lange nicht an.“ (ebd.).
- Georg Knepler: Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, Bd. 1: Frankreich – England, Berlin 1961, 255.
- Hansjürgen Schaefer: … in die Weiten der Zukunft. Franz Liszt zum 75. Todestag am 31. Juli, in: Neues Deutschland, Berliner Ausgabe, 16. Jg., Nr. 211 vom 2. 8. 1961, 4.
- Werner Felix: Franz Liszt: Ein Lebensbild, 2. Aufl. Leipzig 1961, 198.
- György Kroó: Franz Liszts „Ungarische Bildnisse“, in: MuG 11 (1961), 599–603, 602.
- György Kroó: Franz Liszts „Ungarische Bildnisse“, in: MuG 11 (1961), 599–603, 603.
- Luitpold Steidle: Franz Liszt und unsere Zeit, in: Neue Zeit, Berliner Ausgabe, 17. Jg., Nr. 242 vom 15. 10. 1961, 1 f.
- Werner Felix: Liszts Schaffen um 1848: Versuch zur Deutung seiner Programmatik, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae: Bericht über die Zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt, Bartók (Budapest, 1961), Fasc. 1/4, T. 5 (1963), 59–67, 59 f. In seiner Liszt-Biographie von 1961 heißt es außerdem: „So gilt heute die Frage der Anerkennung von Liszts Zugehörigkeit zur ungarischen Nation als Gradmesser dafür, von welcher politischen Plattform aus dieser Künstler gesehen wird.“ (209).
- Kálmán Czomacz Tóth: Virtuose, Weltmann, genialer Komponist. Zum 150. Geburtstag von Franz Liszt, in: Neue Zeit, Berliner Ausgabe, 17. Jg., Nr. 248 vom 22. 10. 1961, 4.
- Hansjürgen Schaefer: Festwoche in Weimar. Die Deutsche Demokratische Republik ehrte Franz Liszt zu seinem 150. Geburtstag, in: Neues Deutschland, Berliner Ausgabe, 16. Jg., Nr. 299 vom 30. 10. 1961, 3.
- Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 591.
- Werner Felix: Liszts Schaffen um 1848: Versuch zur Deutung seiner Programmatik, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae: Bericht über die Zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt, Bartók (Budapest, 1961), Fasc. 1/4, T. 5 (1963), 59–67, 62 f.; „Wir tun deshalb recht daran, ein solches Werk aus der intimen, privaten Sphäre herauszulösen und in die erregenden Zusammenhänge der Zeit seiner Entstehung einzuordnen. Die Musik dieses Werkes zeigt den Komponisten auf einem Höhepunkt seiner schöpferischen Aktivität. Diese Aktivität zog aber ihre Nahrung aus dem vorwärtsdrängenden Geist der revolutionären Bewegung.“ Vgl. dazu Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 49: „If classical humanism was deemed to offer a historical precedent for the enlightened socialist self, the romantics embodied the attributes of the Western other.“
- Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 591. Das Hauptthema von Les Préludes wurde im Zweiten Weltkrieg als Erkennungsmelodie für den Wehrmachtbericht im Rundfunk und in den Wochenschauen verwendet.
- Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 591.
- Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 591.
- Werner Felix: Liszts Schaffen um 1848: Versuch zur Deutung seiner Programmatik, in: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae: Bericht über die Zweite Internationale Musikwissenschaftliche Konferenz Liszt, Bartók (Budapest, 1961), Fasc. 1/4, T. 5 (1963), 59–67, 63.
- Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 592.
- Werner Felix: Franz Liszt. Zum 150. Geburtstag am 22. Oktober, in: MuG 11 (1961), 588–596, 595.
- Werner Felix: Franz Liszt: Ein Lebensbild, 2. Aufl. Leipzig 1961, 214.
- Wolfram Huschke: Zur Liszt-Identität der Musikhochschule Weimar, in: Franz Liszt and Advanced Musical Education in Europe: International Conference (= Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae T. 42, Fasc. 1/2 (2001)), 197–212, 208; s. auch Wolfram Huschke: Nachwirkung in Konzertpraxis und Forschung. Liszt-Pflege in Weimar heute, in: MuG 36 (1986), 350–351, 350. Auch 2010 konstatiert Huschke, hier vor allem mit Blick auf Weimar: „In den folgenden zwei Jahrzehnten [nach 1961] geschah auf Liszt bezogen nicht viel. Die künstlerische und wissenschaftliche Selbstdarstellung der Hochschule zu ihrer Hundertjahrfeier 1972 war eher blamabel. Liszt kam hier so vor, dass der Gesamteindruck eher verstärkt als verwischt wurde, die Hochschule habe ihn inzwischen jenseits von Briefkopf und einer neuen und durchaus hässlichen Liszt-Medaille fast vergessen, als eine alte Gewohnheit, die man lieber nicht reflektiert.“ Wolfram Huschke: Franz Liszt. Wirken und Wirkungen in Weimar, Weimar 2010, 322.
- Hans Rudolf Jung: Liszt-Pflege in der DDR, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), 113–126, 120. URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf.
- Vgl. Wolfgang Hanke: Neubewertung eines Lebenswerkes. Zum Symposion „Franz Liszt und die Kirchenmusik“ in Weimar, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 275 vom 21. 11. 1986, 7.
- Michael von Hintzenstern: Wo einst auch Liszt musizierte. Im Originalzustand erhalten: die Peternellorgel in Denstedt bei Weimar, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 157 vom 5. 7. 1986, 4.
- Vgl. u. a. Michael von Hintzenstern: Zum 100. Todestag von Franz Liszt. „Zukunftsmusik“ der späten Jahre für den sakralen Raum, in: Neue Zeit, Ausgabe B, 42. Jg., Nr. 179 vom 31. 7. 1986, 4.
- Ein Faktor für dieses Interesse könnte u. a. das Erscheinen von Diether de la Mottes Harmonielehre in der DDR 1977 (als Lizenzausgabe) sein: Der Autor widmet in diesem auch in Ostdeutschland intensiv rezipierten Buch Liszts Harmonik ein eigenes Kapitel und geht dabei u. a. auf Drei späte Klavierstücke, auf La lugubre gondola sowie auf die Bagatelle ohne Tonart ein.
- Wolfgang Marggraf: „… den Speer in den unendlichen Raum der Zukunft schleudern“. Traditionsbezüge und Innovationen im Schaffen Franz Liszts, in: MuG 36 (1986), 342–347, 346.
- Wolfgang Marggraf: „… den Speer in den unendlichen Raum der Zukunft schleudern“. Traditionsbezüge und Innovationen im Schaffen Franz Liszts, in: MuG 36 (1986), 342–347.
- Wolfgang Marggraf: „… den Speer in den unendlichen Raum der Zukunft schleudern“. Traditionsbezüge und Innovationen im Schaffen Franz Liszts, in: MuG 36 (1986), 342–347, 347.
- Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 22: „And as with Adorno’s model of lateness in art, the fragmentation of the socialist collective resulted in a climate in which irony flourished.“
- Peter Gülke: Über Liszts „inszenatorisches“ Komponieren, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), Bd. 78, 16–28, 27, URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf.
- Peter Bürger: Theorie der Avantgarde, Frankfurt a. M. 1984, 98.
- Peter Gülke: Über Liszts „inszenatorisches“ Komponieren, in: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 78 (1987), Bd. 78, 16–28, 27, URL: https://www.zobodat.at/pdf/Wiss-Arbeiten-Burgenland_078_0016-0028.pdf.
- Frank Schneider: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162, 150.
- Frank Schneider: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162, 145.
- Frank Schneider: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162, 148.
- Frank Schneider: Génie oblige! Franz Liszt, in: ders.: Welt, was frag ich nach dir? Politische Porträts großer Komponisten, Leipzig 1988, 145–162, 145.
- Elaine Kelly: Composing the Canon in the German Democratic Republic: Narratives of Nineteenth-Century Music, New York 2014, 4: „[T]he relationship between discourse and practice in the GDR was often less than harmonious.“
- Bruno Hinze-Reinhold: Lebenserinnerungen, hg. von Michael Berg, Weimar 1997, 192. In einem 1961 in der Thüringischen Landeszeitung publizierten Artikel („So jung war der alte Liszt!“) heißt es bei Hinze-Reinhold: „Was nun Liszt als selbständigen Tonschöpfer anlangt, so ist es nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt, daß er eigentlich den Unterbau geschaffen hat, auf welchem die ganze neuere Musik steht.“ Demnach sind bei Liszt bereits „schon ganze Blütenknospen“ des Impressionismus nachweisbar; „[s]elbst im Sinne der Zwölftonmusik aufgestellte Themen lassen sich bei ihm nachweisen. In vielen Alterswerken kümmert sich der Komponist überhaupt nicht mehr um harmonische Gesetze. Dieser Expressionismus ist in fast allen Fantasiestücken und Monologen der letzten Lebensjahre zu verspüren. Das Motivische – es sind meist aneinandergereihte Motivfetzen ohne eigentliche Durcharbeitung – ist hochinteressant. Vieles ziemlich gewagt und ungehemmt. Die Härte seiner Tonsprache und die gewisse Atonalität gemahnen geradezu an Hindemith und Bartók […]. In seinen Schlüssen weicht der Meister gänzlich vom Normalen ab und endet kaum mehr wohlgesittet auf der Tonika, sondern irgendwo im Wesenlosen.“ Zit. nach ebd., 194 f.