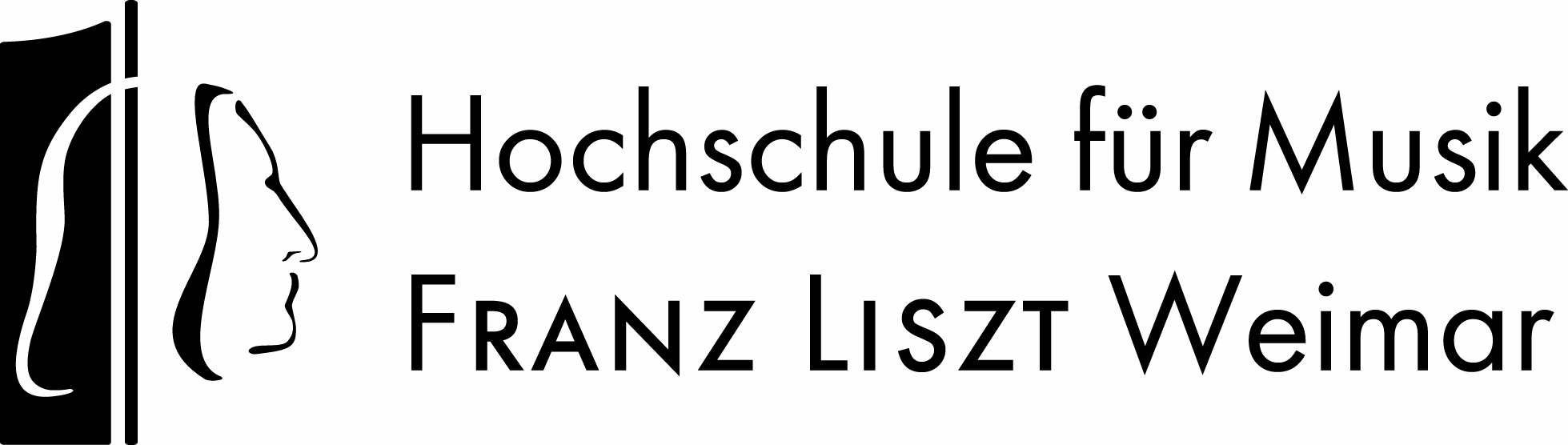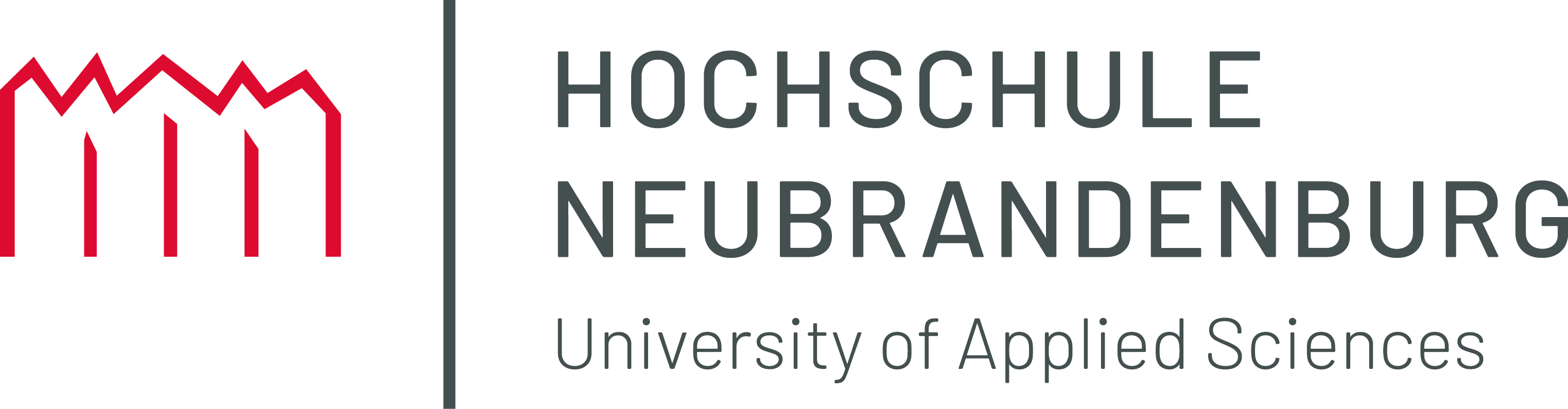Jüdische Musik
Zusammenfassung
Jüdische Musik, jüdische Identität
Geprägt von Geschichten der Migration, des Exils, der Verfolgung und der nationalen Wiederbelebung, verkörpert jüdische Musik die Vielfalt und die Spannungen, die dem jüdischen Dasein selbst innewohnen. Zwar ist es denkbar, bestimmte gemeinsame Elemente in unterschiedlichen Repertoires zu identifizieren, insbesondere in der mit liturgischen Funktionen und Texten verbundenen Musik, doch der Versuch, auf der Grundlage musikalischer Gattungen oder Stile eine einheitliche Geschichte aller jüdischen Musik zu konstruieren, muss spekulativ bleiben.Innerhalb des Paradigmas der vergleichenden Musikwissenschaft veranschaulichen Abraham Zvi Idelsohns Studien den Versuch, eine einheitliche Geschichte der jüdischen Musik zu konstruieren. Abraham Zvi Idelsohn: Jewish Music in its Historical Development, New York 1972 [1929]. Für eine umfassende Diskussion der Geschichtsschreibung der jüdischen Musik s. Edwin Seroussi: Jüdische Musik, in: Laurenz Lütteken (Hg.): MGG Online, Kassel 2016; online unter: https://www-1mgg-2online-1com-1008e20pu0071.erf.sbb.spk-berlin.de/mgg/stable/537670 (1. 1. 2025). Es gibt nicht eine „jüdische Musik“, sondern viele, von denen jede ihrer eigenen historischen Entwicklung folgt und unterschiedliche Beziehungen zu den verschiedenen Dimensionen jüdischen Lebens sowie zu den Gesellschaften widerspiegelt, in denen Juden gelebt haben. Im Folgenden wird jüdische Musik in einem weiten Sinne verstanden, als von Juden geschaffene Musik, die einen Aspekt jüdischer Erfahrung reflektiert.Diese Definition folgt der Diskussion jüdischer Kunst bei Matthew Baigell und Milly Heyd in: Matthew Baigell und Milly Heyd (Hg.): Complex Identities: Jewish Consciousness and Modern Art, New Brunswick, NJ, und London 2001, XIV. Siehe auch Klára Móricz: Jewish Identities: Nationalism, Racism, and Utopianism in Twentieth-Century Music, Berkeley, Los Angeles und London 2008 (= California Studies in 20th-Century Music 8), 2. Diese Erfahrung umfasst nicht nur jene Vorstellungen und Praktiken, die den jüdischen Lehren und dem jüdischen Erbe inhärent sind, sondern ebenso die Realitäten jüdischer Existenz als distinkte Minderheit, einschließlich der sich wandelnden Erscheinungsformen des Antisemitismus.
Wie sich in kulturellen Praktiken zeigt, ist die jüdische Erfahrung häufig davon geprägt gewesen, wie Juden von der nichtjüdischen Welt wahrgenommen wurden und weiterhin wahrgenommen werden, ebenso wie von politischen Regimen und öffentlichen Institutionen. Prozesse der Innovation, der Akkulturation, der Transformation und der Hybridisierung in der Geschichte jüdischer Kunst sind eng mit theologischen Vorstellungen, sozialen Bewegungen und selbst mit Reaktionen auf Blutbeschuldigungen und Verschwörungstheorien verflochten.Zu jüdischer Musik und antisemitischen Tropen s. Ruth HaCohen: The Musical Libel against the Jews, New Haven 2011, und Annkatrin Dahm: Der Topos der Juden. Studien zur Geschichte des Antisemitismus im deutschsprachigen Musikschrifttum, Göttingen 2007 (= Jüdische Religion, Geschichte und Kultur 7). Dies unterstreicht die Bedeutung, sowohl Produktion als auch Rezeption zu berücksichtigen, um zu verstehen, wie Stile und andere musikalische Elemente als spezifisch jüdisch verstanden, identifiziert und projiziert worden sind. In diesem Rahmen besitzt jüdische Musik keine fixe formale oder funktionale Identität, vielmehr konstituiert sie ein dynamisches Medium, das kontinuierlich auf sich wandelnde Bedürfnisse und Bedeutungen reagiert und damit veranschaulicht, was Philip V. Bohlman als die ontologischen Momente jüdischer Musik beschrieben hat.Philip V. Bohlman: Ontologies of Jewish Music, in: Joshua S. Walden (Hg.): The Cambridge Companion to Jewish Music, Cambridge 2015, 11–26.
So verstanden reicht der Horizont der Geschichte jüdischer Musik weit über die Grenzen liturgischer und volkstümlicher Traditionen hinaus. Der klassizistische Romantizismus Felix Mendelssohn Bartholdys etwa ist Teil der Geschichte jüdischer Assimilation in Deutschland, ebenso wie die Laufbahnen anderer Musiker jüdischer Herkunft, die das Judentum nicht ausdrücklich zum Thema ihres Schaffens machten. Ob Musiker jener Zeit ihre künstlerischen Unternehmungen in solchen Begriffen verstanden, ist aus der Perspektive der zeitgenössischen Geschichtsschreibung jüdischer Musik von nachgeordneter Bedeutung. Die historischen Kontexte, in denen von Juden komponierte Musik zirkulierte und interpretiert wurde, zeigen, dass künstlerische Werke nicht weniger als menschliche Kollektive durch eine geschichtlich konstituierte Bedingung miteinander verbunden sein können und so das bilden, was mitunter als Schicksalsgemeinschaft bezeichnet wird.
Ideologien jüdischer Musik
Das 20. Jahrhundert steht als tragisches Zeugnis für diesen Zustand.Siehe auch Michael Haas: Forbidden Music: The Jewish Composers Banned by the Nazis, New Haven 2013. Die Verfolgung und Vernichtung jüdischer Musiker sowie der Ausschluss ihrer Werke aus Konzertprogrammen während des NS-Regimes beruhten auf einer rassifizierten Wahrnehmung jüdischer Identität, die durch tief verwurzelte, religiös geprägte antijüdische Vorurteile und Ressentiments weiter verschärft wurde. In seiner säkularisierten, pseudowissenschaftlichen Form durchdrang der Antisemitismus den intellektuellen Diskurs und führte „Jüdischkeit“ als negative Bewertungskategorie im Bereich der Kunst ein. Wie David Nirenberg erläutert, „konnten selbst diejenigen, die rassistische Rhetorik für vulgär hielten, dennoch mit den Rassisten ein gemeinsames negatives Empfinden gegenüber der ‚Jüdischkeit‘ [Jewishness] bestimmter Stile und Bewegungen teilen“. „Es war die Logik der Kunstkritik, die das ‚Judentum‘ hervorbrachte, nicht die wirklichen Überzeugungen oder die Genealogie ihres Gegenstands.“David Nirenberg: Anti-Judaism: The Western Tradition, New York 2013, 455 f. Auf dem Gebiet der Musik war diese negative Konzeption von Jüdischkeit bereits in Richard Wagners Das Judenthum in der Musik etabliert worden und kulminierte schließlich in der Ausstellung Entartete Musik, die sich gegen Persönlichkeiten wie Arnold Schönberg und Kurt Weill richtete, ebenso wie gegen nichtjüdische Komponisten wie Ernst Krenek.Mehr dazu: Pamela M. Potter: Twentieth-Century Reception and Anti-Semitism, in: David Trippett (Hg.): Wagner in Context, Cambridge 2024, 364–372.
Die Wiederbelebung der Musik jüdischer Komponisten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beseitigte keineswegs die Assoziation dieses Repertoires mit dem Judentum. Im Gegenteil: Gerade weil sie unter der NS-Herrschaft verboten gewesen war, galten Aufführungen von Werken jüdischer Komponisten, wenn auch nicht ausschließlich, in der Nachkriegszeit als Embleme der Befreiung. Das erste Nachkriegskonzert der Berliner Philharmoniker im Mai 1945 unter der Leitung von Leo Borchard setzte einen Präzedenzfall, indem es Werke von Mendelssohn Bartholdy aufführte. Wie Toby Thacker feststellte, war 1945 die Aufführung oder Ausstrahlung einer Mendelssohn-Ouvertüre oder einer Tschaikowski-Sinfonie gleichbedeutend mit einer antifaschistischen Stellungnahme, deren Inhalt so offensichtlich war, dass eine weitere Erläuterung überflüssig war.Toby Thacker: Music after Hitler, 1945–1955, Aldershot 2007, 75. Die politische Semantik dieser Wiederbelebung fand bei den Kritikern der Nachkriegszeit starken Widerhall. Ein Autor der Berliner Zeitung reflektierte über die neu gewonnene Freiheit in der Musik und bemerkte, dass „[a]uch dem Reich der Töne […] nun die Freiheit wiedergegeben“ ist. „Lang entbehrte, geliebte Melodien, die wir nur heimlich summen durften, können wir wieder hören, und manche verfemt gewesene Partitur ist zu neuem hellen Klang erwacht.“Albert Hirte: Befreite Klänge, in: Berliner Zeitung, 1. Jg., Nr. 63 vom 27. 7. 1945, 4.
In einer stärker doktrinären und politisch instrumentalisierten Form wurde die Idee des Antifaschismus zu einem Grundpfeiler des offiziellen marxistisch-leninistischen Weltbildes der DDR und zu einem zentralen Bestandteil ihrer Kulturpolitik. Gelöst von seinen historischen Ursprüngen, wurde der Begriff Faschismus im öffentlichen Diskurs häufig austauschbar mit „Kapitalismus“ und „Imperialismus“ verwendet und diente als pauschale Verurteilung nahezu alles dessen, was die herrschende SED als politisch oder kulturell unerwünscht erachtete.Zur ideologischen Funktion des Antifaschismusbegriffs in der DDR s. Gerd Dietrich: Kulturgeschichte der DDR, Göttingen 2018, 68 ff. Diese Tendenz erstreckte sich auch auf künstlerische Werke und Praktiken, die von der Doktrin des Sozialistischen Realismus abzuweichen schienen. Dieser Punkt wird später noch ausführlicher behandelt werden, doch muss bereits jetzt festgehalten werden, dass das Schicksal jüdischer Musik in der DDR maßgeblich von zwei voneinander unterscheidbare, aber miteinander verbundene Faktoren beeinflusst wurde: a) der parteiamtlichen Sichtweise auf das Judentum und b) den vom Staat vorgegebenen ästhetischen Prinzipien. Erstere blendete die spezifische Geschichte und die Traditionen des Judentums häufig aus oder marginalisierte sie und bevorzugte stattdessen eine universalistische „antifaschistische“ Identität. Gleichwohl wird die verbreitete, aber unzutreffende Wahrnehmung der DDR als kulturell monolithisch der komplexen Realität jüdischen Kulturlebens in Ostdeutschland nicht gerecht. Nicht alles, was offiziell missbilligt wurde, verschwand vollständig, und selbst bestimmte jüdische Kulturformen, die den Erwartungen des Regimes zu entsprechen schienen, stellten dessen ideologische Dogmen auf subtile, mitunter auch auf offene Weise infrage.
Die Erforschung des Feldes jüdischer Musik in der DDR eröffnet daher wertvolle Einsichten in umfassendere Fragestellungen der jüdischen Geschichte, insbesondere wenn sie neben alternativen Konzeptionen jüdischer Identität in Musik und Kultur betrachtet wird. Angesichts des Umfangs dieses Beitrags muss eine umfassende Untersuchung jedoch einem anderen Anlass vorbehalten bleiben. Die vorliegende Diskussion wird daher im Zusammenhang mit einer solchen Konzeption fortgeführt, nämlich der der frühen israelischen Kunstmusik. Diese Wahl ist weder willkürlich noch lediglich pragmatisch. Als Idealtypen artikulieren die ostdeutschen und israelischen Konzeptionen jüdischer Musik kontrastierende Auffassungen jüdischer Identität: Erstere, zumindest in der Darstellung parteilicher Ideologen, betonte eine supranationale Klassensolidarität und ökonomischen Determinismus, letztere hingegen hob das nationale Erbe und eine innerjüdische Eigenständigkeit hervor. Diese Perspektiven sind jedoch nicht grundsätzlich unvereinbar. Vielmehr unterscheiden sie sich in ihrer Gewichtung: Die eine privilegiert universale Bindungen, die andere rückt kulturelle und historische Besonderheiten in den Vordergrund. Zudem erheben sowohl Universalismus als auch Partikularismus Identitätsansprüche und können insofern nicht nur Verbindungen stiften, sondern auch Trennungen erzeugen.Vgl. Sarah Collins: The National and the Universal, in: Paul Watt, Sarah Collins und Michael Allis (Hg.): The Oxford Handbook of Music and Intellectual Culture in the Nineteenth Century, New York 2020, 369–386, 370.
Vor diesem Hintergrund lassen sich die ideologischen Implikationen der vielfältigen Formen jüdischer Musik, die in der DDR produziert und aufgeführt wurden, ebenso klarer erkennen wie ihr Verhältnis zu anderen Erscheinungsformen jüdischen Lebens. Die Spannung zwischen den universalen und den partikularen Dimensionen jüdischer Musik hat jedoch weder ihren Ursprung in der DDR noch ist sie ausschließlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden. Um ihre volle Bedeutung zu erfassen und die komplexe Rolle der Rezeption bei der Formung von Vorstellungen von Jüdischkeit in der Musik zu verstehen, ist ein kurzer historischer Exkurs unerlässlich. Zunächst werde ich die Fälle Arnold Schönbergs und Gustav Mahlers erörtern, bevor ich mich dem ostdeutschen Kontext zuwende.
Dynamiken von Produktion und Rezeption
Lange vor seiner offiziellen Rückkehr zum jüdischen Glauben und seinem groß angelegten kompositorischen Engagement mit jüdischen Themen war Schönbergs jüdischer Hintergrund in den Wiener journalistischen Reaktionen auf seine Musik und deren Aufführung bereits zu einem Streitpunkt geworden. Ein Kritiker, der 1909 ein Konzert des Rosé-Quartetts mit dem 2. Streichquartett besprach, verspottete sowohl Schönberg als auch die Interpreten und bediente sich dabei eines Repertoires antisemitischer Klischees:
„Das Vierspiel Rose wurde also mitten in der Arbeit unterbrochen, weil einige Zuhörer von den widerlichen Klängen der Schönbergschen Muse, die sich von Griechenland offenbar einmal nach Palästina verirrt hat, anscheinend derart wütend wurden, daß sie nicht übel Lust zeigten, Herrn Schönberg ein wenig zu ‚massieren‘. […]. Ob das Ganze nicht vielleicht ein jüdischer Schwindel war, der nur die Aufgabe hatte, die allgemeine Aufmerksamkeit auf Herrn Schönberg zu richten, bleibe dahingestellt. […]. Man kennt ja die ewig gleich bleibenden Judenwitze, mit denen die Mischpoche ihre Lieblinge populär machen will.„-walt“ in: Alldeutsches Tagblatt, 7. Jg. (1909), vom 31. 1. 1909; zitiert nach Martin Eybl (Hg.): Die Befreiung des Augenblicks: Schönbergs Skandalkonzerte 1907 und 1908. Eine Dokumentation, Wien 2004 (= Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 4), 237.
Die Unterstellung jüdischer Täuschung und, durch den Verweis auf Palästina, die Konstruktion der Juden als fremdes „östliches“ Element inmitten der westlichen Kultur knüpfen an tradierte antisemitische Topoi an. Obwohl diese Rezension ein extremes Beispiel antisemitischer Rhetorik im Musikjournalismus der Zeit darstellt, war ein solches Vorurteil im Wien des frühen 20. Jahrhunderts keineswegs außergewöhnlich.Vgl. Martin Eybls Diskussion in: ders.: (Hg.): Die Befreiung des Augenblicks: Schönbergs Skandalkonzerte 1907 und 1908: Eine Dokumentation, Wien 2004 (= Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 4), 37 ff. Mit dem Erstarken des rassischen Antisemitismus in der europäischen Gesellschaft wurden Verweise auf Schönbergs jüdischen Hintergrund und auf den anderer jüdischer Künstler und Intellektueller zunehmend als Mittel zur Delegitimierung ihrer kulturellen Leistungen eingesetzt. Diese Umstände beeinflussten in komplexer und oft schmerzlicher Weise auch die jüdische Selbstwahrnehmung. Rückblickend auf seine prägenden Jahre als junger Musiker beschrieb Schönberg später den tiefgreifenden Einfluss von Antisemitismus und deutschem Nationalismus auf das jüdische Selbstverständnis:
“When we young Austrian-Jewish artists grew up, our self-esteem suffered very much from the pressure of certain circumstances. It was the time when Richard Wagner’s work started its victorious career, and the success of his music and poems was followed by an infiltration of his Weltanschauung, of his philosophy. You were no true Wagnerian if you did not believe in his philosophy, in the ideas of Erlösung durch Liebe, salvation by love; you were not a true Wagnerian if you did not believe in Deutschtum, in Teutonism; and you could not be a true Wagnerian without being a follower of his anti-Semitic essay, Das Judentum in der Musik, ‘Judaism in Music’.”Arnold Schoenberg: Two Speeches on the Jewish Situation, in: ders.: Style and Idea: Selected Writings, hg. von Leonard Stein, übers. von Leo Black, mit einem neuen Vorwort von Joseph Auner, Berkeley u. a. 1984, 501–505, 502 f.
Schönbergs Erinnerung ist im Lichte der künstlerischen Entwicklung, die ihn zur dodekaphonen Komposition führte, aufschlussreich. Seine frühen atonalen Werke, etwa das Zweite Streichquartett, gingen aus einer charakteristischen Synthese von Johannes Brahms’ „entwickelnder Variation“ und Richard Wagners „schwebender Tonalität“ hervor. Diese Fusion, verbunden mit Schönbergs Streben nach ästhetischer Ökonomie, veranlasste schließlich seinen Abschied von der funktionalen Tonalität und ihren etablierten harmonischen und melodischen Konventionen.Zu einer Untersuchung von Wagners Einfluss auf Schönbergs Hinwendung zur Atonalität s. Julie Brown: Schoenberg and Redemption, Cambridge 2014 (= New Perspectives in Music History and Criticism). Zu Wagner und Antisemitismus s. die Beiträge in: Hannes Heer, Christian Glanz und Oliver Rathkolb (Hg.): Richard Wagner und Wien. Antisemitische Radikalisierung und das Entstehen des Wagnerismus, Wien 2017 (= Musikkontext 11). Bekanntlich verstand er diese Transformation nicht als Bruch mit der deutschen Musiktradition, sondern als deren logische Vollendung, eine Position, die er in den 1920er Jahren nach der Formalisierung seiner Zwölftontechnik mit wachsender Entschiedenheit vertrat.
In welchem Maße Schönbergs kompositorischer Ansatz – abgesehen von den Werken, die ausdrücklich jüdischen Themen gewidmet sind – mit seiner jüdischen Identität oder dem von ihr ausgehenden sozialen Druck verflochten war, bleibt umstritten. Bemerkenswert ist, dass Wahrnehmungen „jüdischer“ Merkmale in seinen frühen atonalen Werken nicht auf antisemitische Kritiker beschränkt waren, sondern auch bei Denkern anzutreffen sind, die seiner Musik und seinem jüdischen Erbe ausgesprochen wohlwollend gegenüberstanden. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1922 führte Heinrich Berl Aspekte der Musik sowohl Schönbergs als auch Mahlers, ebenso wie das Unverständnis, das ihre Werke bei Kritikern und Publikum hervorriefen, auf ihre jüdische Herkunft zurück.Mehr dazu: Karen Painter: Polyphony and Racial Identity: Schoenberg, Heinrich Berl, and Richard Eichenauer, in: Music & Politics 5/2 (2011); online unter: https://quod.lib.umich.edu/m/mp/9460447.0005.203/--polyphony-and-racial-identity-schoenberg-heinrich-berl?rgn=main;view=fulltext (1. 1. 2025). Indem er Jüdischkeit als positives Merkmal reklamierte und Wagners pejorative Verwendung bewusst umkehrte, argumentierte Berl, die schöpferische Kraft dieser beiden Wiener Komponisten gehe auf eine „asiatische“ Neigung zu Melodie und Lyrik zurück.Heinrich Berl: Das Judentum in der abendländischen Musik, in: Der Jude. Eine Monatsschrift 6 (1921/22), 495–505, 495. Eine verwandte Denkfigur findet sich in den Schriften jüdischer und israelischer Autoren des frühen 20. Jahrhunderts. Max Brod, vor allem bekannt als Freund Franz Kafkas und Verwalter seines Nachlasses, erörterte Mahlers Musik in Martin Bubers Zeitschrift Der Jude mehrere Jahre, bevor Berls Essay in derselben Publikation erschien. Nach Brod äußere sich das jüdische Wesen von Mahlers Kompositionen in ihrem „scharf ausgeprägten Marschrhythmus“, der an chassidische Volkslieder erinnere.Max Brod: Gustav Mahlers jüdische Melodien, in: Musikblätter des Anbruch 2 (1920), 378 f., sowie ders.: Jüdische Volksmelodien, in: Der Jude. Eine Monatsschrift 1 (1916/17), 344 f. In seinen späteren Schriften, die sich auch mit den Werken israelischer Komponisten befassten, entwickelte Brod seine Vorstellungen vom östlichen Charakter jüdischer Musik weiter und glaubte in Mahlers Technik der motivischen Variation entfernte Anklänge an die Art der biblischen Kantillation zu erkennen.Max Brod und Yehuda Walter Cohen: Die Musik Israels, Kassel u. a. 1976, 18. Der erste Teil dieses Buches wurde 1951 von Brod abgeschlossen.
In erheblichem Maße war diese Reklamation jüdischer Fremdheit in der Musik Teil eines breiteren Spektrums von Reaktionen auf die anschwellende Welle des Antisemitismus, die den Boden für spätere Verfolgungen bereitete. In einem zunehmend feindlichen Umfeld konnte das Gefühl von Bedrohung und Unsicherheit in unterschiedliche, mitunter gegensätzliche Richtungen führen, von dem, was Theodor Lessing als „jüdischen Selbsthass“ bezeichnete, bis hin zu einer selbstbewussten Hinwendung zu einer jüdischen nationalen oder kulturellen Identität.Theodor Lessing: Der jüdische Selbsthass, Berlin 1984 [1930]. Schönberg wählte bekanntlich den zweiten Weg und wandte sich in einigen seiner ambitioniertesten Werke entschieden jüdischen Themen zu, insbesondere in A Survivor from Warsaw und seiner unvollendeten Oper Moses und Aron. Sein vertieftes Engagement mit dem Judentum fand auch Ausdruck in seiner liturgischen Komposition Kol Nidre und in seinem Drama Der biblische Weg, das auf die Ideen des Wiener Schriftstellers und politischen Zionisten Theodor Herzl anspielt.Vgl. Mark Berry: Arnold Schoenberg’s “Biblical Way”: From “Die Jakobsleiter” to “Moses und Aron”, in: Music & Letters 89 (2008), 84–108.
Universalismus versus Partikularismus
Während viele führende frühe israelische Komponisten und Musikkritiker Schönberg tief bewunderten, führte sie ihre Vorstellung einer partikularistischen jüdischen Identität in der Musik zunächst auf einen anderen ästhetischen Weg, einen Weg, der das „orientalische“ Element in den Mittelpunkt ihres Schaffens stellte. Anders als die von Berl und Brod identifizierten „orientalischen“ Qualitäten, die häufig implizit oder sogar rein konjektural waren, griffen frühe israelische Komponisten bewusst und mit Begeisterung auf die musikalischen Traditionen des Nahen Ostens zurück. Prägende Figuren wie Paul Ben-Haim (geboren Frankenburger) und Menachem Avidom (geboren Manuel Mendel Mahler-Kalkstein) integrierten Elemente des Synagogengesangs, jüdischer Volkstraditionen und vielfältiger östlicher Einflüsse in musikalische Formen und Gattungen, die ihnen als europäisch ausgebildeten Komponisten vertraut waren.Menachem Avidom war über seine Mutter, die eine Cousine Gustav Mahlers war, mit diesem familiär verwandt.
Zugleich hatte dieser Ansatz bedeutende Vorläufer bei jüdischen Komponisten in der Diaspora. In bescheidenem Umfang baute Charles-Valentin Alkan synagogale Motive in mehrere seiner Werke ein, während er fest in der europäischen Romantik verankert blieb. Ein direkteres Vorbild war der in der Schweiz geborene amerikanische Komponist Ernest Bloch. Als Befürworter der Schaffung einer eigenständigen jüdischen Kunstmusik kritisierte Bloch seine jüdischen Komponistenkollegen dafür, dass sie es „bewusst oder unbewusst, aus Angst oder mangelnder Selbsterkenntnis […] versäumt haben, sich in ihrer Kunst zu bekennen“.Zitiert nach Gdal Saleski: Famous Musicians of Jewish Origin, New York 1949, 20. Für israelische Komponisten wurde dieser Aufruf zu einem bewussten Bemühen, ein partikularistisches jüdisches Selbst innerhalb der breiteren Bewegung der jüdischen nationalen Erneuerung im Land Israel zum Ausdruck zu bringen.
Die Hinwendung zu jüdischem musikalischem Material und zur Klanglandschaft des Nahen Ostens schloss jedoch die Auseinandersetzung mit internationalen modernistischen Strömungen keineswegs aus, insbesondere mit jenen, die stärker volkstümlich orientiert waren. Béla Bartók und Zoltán Kodály dienten dabei als wichtige Modelle für die Entwicklung eines zeitgenössischen nationalen Klangsprache, ebenso wie die impressionistischen Idiome Maurice Ravels und Claude Debussys, die ihrerseits auf östliche, insbesondere asiatische Einflüsse zurückgriffen.Vgl. Ronit Seter: Israelism: Nationalism, Orientalism, and the Israeli Five, in: The Musical Quarterly 97 (2014), 238–308. In den letzten Jahrzehnten ist diese europäische Wendung zu orientalischen Idiomen zunehmend im Rahmen postkolonialer Kritiken des Orientalismus untersucht worden.Vgl. Assaf Shelleg: Jewish Contiguities and the Soundtrack of Israeli History, New York u. a. 2014, 5 ff., und Ronit Seter: Israelism: Nationalism, Orientalism, and the Israeli Five, in: The Musical Quarterly 97 (2014), 238–308. Ein entscheidender Unterschied besteht jedoch darin, dass die orientalisch geprägten Elemente in israelischen Musikwerken nicht dazu dienten, ferne und fremde Welten darzustellen, sondern vielmehr ein spezifisch jüdisches Selbst und die Wiederbelebung hebräischer Kultur zu artikulieren. Als Form der Selbstrepräsentation implizieren Anspielungen auf den Osten ein subtil verflochtenes Wechselspiel zwischen Bezugnahmen auf jüdische Traditionen, sowohl europäische als auch nahöstliche, und Reaktionen auf lang etablierte musikalische Signifikanten von Jüdischkeit in der westlichen Kunstmusik.

Bei aller Heterogenität und allen Widersprüchen wurde der „mediterrane Stil“ (ein von Alexander Uriah Boskovich und Max Brod geprägter Begriff) in der israelischen Musik als bewusste Bekräftigung jüdischen Partikularismus verstanden, der den assimilationistischen und universalistischen Tendenzen jüdischer Musik in der Diaspora entgegengesetzt war. In seiner Befürwortung dieses Stils argumentierte Brod, er stelle nicht nur eine Abkehr von der diasporischen jüdischen Musik dar, sondern bedeute zugleich eine grundlegende Zurückweisung einiger ihrer zugrunde liegenden ästhetischen Prämissen. Den übermäßigen Sekundschritt, wie er etwa im Beginn von Charles-Valentin Alkans „Ancienne mélodie de la synagogue“ erscheint, betrachtete er als emblematisch für musikalische Darstellungen von Jüdischkeit in der Diaspora, jedoch als unzureichend für die Epoche der jüdischen nationalen Wiedergeburt. In Anlehnung an Hayyim Nahman Bialiks Kritik an der jiddischen Sprache bezeichnete Brod die übermäßige Sekunde zudem als eine obsolet gewordene „Hilfstonleiter“, die einst notwendig gewesen sei, um jüdische Musik vor der vollständigen Assimilation in das europäische Dur-Moll-Tonalsystem zu bewahren.Max Brod und Yehuda Walter Cohen: Die Musik Israels, Kassel u. a. 1976, 27.
Orientalismus und Selbstbehauptung
Ungeachtet der künstlerischen Strategien, mit denen Assoziationen zum Orient evoziert wurden, bergen solche Gesten das Risiko, antisemitische Stereotype von Juden als Fremdkörper innerhalb der europäischen Gesellschaft zu verstärken. Das Konzept der jüdischen Selbstablehnung erscheint hier einschlägig, wie auch in der Diskussion nichtisraelischer jüdischer Komponisten, wenn auch in modifizierter Form. Die Verwendung orientalistischer Elemente, wie der übermäßigen Sekunde, zur Artikulation jüdischer Identität war tief mit westlichen Wahrnehmungen von Juden verflochten und deshalb lange Zeit nahezu unvermeidlich, solange keine tragfähigen Alternativen bestanden. Schließlich beruhen musikalische Repräsentationen von Jüdischkeit auf der Fähigkeit der Hörerschaft, bestimmte musikalische Symbole oder Indizes als „jüdisch“ zu erkennen, unabhängig davon, ob sie von jüdischen oder nichtjüdischen Komponisten verwendet werden oder sogar von Musikern wie Modest Mussorgski stammen, dessen Charakterisierung jüdischer Figuren in „Samuel“ Goldenberg und „Schmuÿle“ aus Bilder einer Ausstellung häufig durch die Linse antisemitischer Stereotypisierung gelesen worden ist.Zu Mussorgski und Antisemitismus s. Richard Taruskin: Musorgsky: Eight Essays and an Epilogue, Princeton 1993, 379 ff.
Demgegenüber bemühten sich frühe israelische Komponisten sowohl darum, auferlegte Stereotype zu überwinden, als auch darum, jüdischen musikalischen Ausdruck nach eigenen Maßstäben neu zu definieren. Vor diesem Hintergrund bleibt offen, ob innerjüdische Selbstablehnung in der Musik überhaupt mit orientalisierten Elementen in Verbindung gebracht werden sollte, auch wenn entsprechende Deutungen aufgrund externer Wahrnehmungen von Juden und antisemitischen Zuschreibungen naheliegend erscheinen mögen. In Theodor Lessings Konzeption bezeichnet „jüdischer Selbsthass“ eine innere Disposition, die durch übermäßige Schuldgefühle, Selbstquälerei und die Zurückweisung oder gar Verunglimpfung der eigenen jüdischen Identität gekennzeichnet ist.Lessing: Der jüdische Selbsthass. Siehe insbes. die Kapitel über Otto Weininger und Arthur Trebitsch. Dem steht ein affirmatives Verständnis jüdischer Andersheit als Quelle von Vitalität und Kreativität scharf entgegen. Aus dieser Perspektive bietet Brods Zuordnung dieser Disposition zur musikalischen Assimilation, und nicht zur Hinwendung zu östlichen Musiktraditionen als Grundlage einer jüdischen Kunstmusik, eine aufschlussreiche Einsicht, die in seiner Rolle als sowohl Zeuge als auch Akteur der kulturellen Auseinandersetzungen seiner Zeit gründet.Max Brod und Yehuda Walter Cohen: Die Musik Israels, Kassel u. a. 1976, 13.
Zudem ist daran zu erinnern, dass europäische antisemitische Stereotype in der Musik keineswegs auf Vorstellungen von Juden als orientalisierten, archaisierten Figuren beschränkt waren. Umgekehrt stellte der antisemitische Diskurs Juden, religiöse wie säkulare, auch als hypermodern, übermäßig intellektualistisch, wurzellos und großstädtisch-dekadent dar. Die nationalsozialistische Publikation Lexikon der Juden in der Musik veranschaulicht diese Widersprüchlichkeit, indem sie Schönbergs Zwölftontechnik mit einer „jüdischen Gleichmacherei“ in Verbindung brachte und Heinrich Schenkers Musiktheorie als eine „jüdische Philosophie“ bezeichnete, die „einen seelischen Inhalt im Tonwerk ableugnet“.Theo Stengel und Herbert Gerigk: Lexikon der Juden in der Musik, Berlin 1940, 245 und 239. Weder die Pflege avanciertester musikalischer Idiome noch die Verehrung des deutschen Kanons konnten solche Vorurteile bei jenen entkräften, die ihnen anhingen. Da antisemitische Wahrnehmungen von Jüdischkeit in der Musik vielfältige, ja sogar widersprüchliche Formen annehmen konnten, dürfen Werke, die solche Wahrnehmungen zu spiegeln scheinen, nicht allein nach ihren musikalischen Eigenschaften beurteilt werden, sondern müssen in ihren weiteren kulturellen und historischen Kontexten betrachtet werden; unter Einbeziehung von Fragen der Intention, der Vermittlung sowie der spezifischen Weise, in der Jüdischkeit als negative, positive oder neutrale Zuschreibung gerahmt wird.
Spaltung jüdischer Identität
Die Spannung zwischen externen, oft antisemitischen Vorstellungen von Jüdischkeit und innerjüdischen Selbstdefinitionen fand in der DDR einen besonders starken Widerhall, wo Juden die Realitäten der marxistisch-leninistischen Ideologie und der Geopolitik des Kalten Krieges navigierten. Wie Karin Hartewig feststellt, vollzog sich die Erfahrung der Mehrheit der kommunistischen Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Ostdeutschland remigrierten, im Gleichklang mit der Vision einer „roten Assimilation“. Diese Gruppe war zumeist „atheistisch, links und kommunistisch, antibürgerlich, antiliberal und antizionistisch“.Karin Hartewig: Zurückgekehrt: Die Geschichte der jüdischen Kommunisten in der DDR, Köln, Weimar und Wien 2000, 4. In der Regel verstanden sie jüdische Identität entweder als ein Relikt der Vergangenheit oder als ein universales ethisches Engagement für soziale Gerechtigkeit. Im Unterschied zu früheren Formen der Assimilation war die rote Assimilation nicht bloß eine Frage der Anpassung oder Akkulturation in der Mehrheitsgesellschaft. Als Bestandteil der kommunistischen Sozialutopie verkörperte sie die Vision einer im Entstehen begriffenen neuen Welt, die versprach, soziale Ungerechtigkeit, einschließlich des Antisemitismus, ein für alle Mal zu überwinden. Zugleich eröffnete sie Juden die Möglichkeit, aktiv zu dieser Transformation beizutragen.Vgl. Karin Hartewig: Zurückgekehrt. Die Geschichte der jüdischen Kommunisten in der DDR, Köln, Weimar und Wien 2000, 27 ff. Im Vokabular des historischen Materialismus ausgedrückt: Sie konnten gemeinsam mit dem Proletariat zu Subjekten statt zu Objekten der Geschichte werden, wenn auch in einer anderen Weise, als sie im Zionismus konzipiert wurde. Obwohl sie zahlenmäßig nur gering vertreten waren, erlangten ostdeutsche Musiker jüdischer Herkunft wie Hanns Eisler und Ernst Hermann Meyer innerhalb der Musikkultur der DDR prominente Positionen, nicht zuletzt aufgrund ihres ausgeprägten Engagements für dieses utopische Projekt.Zu Eisler als jüdischem Komponisten s. Andrea F. Bohlman und Philip V. Bohlman: Hanns Eisler. „In der Musik ist es anders“, Berlin 2012 (= Jüdische Miniaturen 126).
Die politische Bedeutung jüdischer Präsenz in der DDR war eng mit dem Selbstbild des Staates als Bastion humanistischer und antifaschistischer Ideale verknüpft. Ostdeutsche Juden, insbesondere jene in einflussreichen politischen oder kulturellen Positionen, konnten dieses Bild nach innen wie nach außen stützen, indem sie ihm Glaubwürdigkeit und moralische Autorität verliehen.Vgl. Karin Hartewig: Zurückgekehrt. Die Geschichte der jüdischen Kommunisten in der DDR, Köln, Weimar und Wien 2000, 3 ff. Zugleich vollzog sich diese Selbstdarstellung im Rahmen der sowjetischen antiwestlichen und damit auch antiisraelischen Propaganda, die zur Herausbildung des Phänomens beitrug, das heute als „neuer Antisemitismus“ bezeichnet wird, dessen israelfokussierte Ausrichtung auch lange nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Blocks fortbestand und bis in die Gegenwart reicht.1971 hob der Philosoph und Musikwissenschaftler Vladimir Jankélévitch die Position Israels im Antisemitismus der Zeit nach dem Holocaust hervor und bemerkte: „[Den Juden] wurde nicht vorgeworfen, dies oder jenes zu bekennen, ihnen wurde vorgeworfen, zu sein. Bis zu einem gewissen Grad erstreckt sich diese Verweigerung sogar heute noch auf die Existenz des Staates Israel.“ Vladimir Jankélévitch: Should We Pardon Them?, in: Critical Inquiry 22 (1996), 552–572. Ann Hobart übersetzte diesen Artikel aus seiner ursprünglichen Veröffentlichung von 1965 ins Englische. Obwohl der rassische Antisemitismus im sowjetischen Einflussbereich offiziell verurteilt wurde, reproduzierten politische Kampagnen weiterhin verfestigte Stereotype, indem sie Juden als „Kosmopoliten“ darstellten oder sie verdächtigten, als Agenten des „Zionismus“ und des „amerikanischen Imperialismus“ zu dienen.Mehr dazu bei Cathy Gelbin und Sander Gilman: Cosmopolitanisms and the Jews, Ann Arbor 2017 (= Social History, Popular Culture, and Politics in Germany).
Gleichzeitig – und auch dies unterstreicht erneut die selbstwidersprüchliche Natur antisemitischen Denkens – zeigten sowjetische und ostdeutsche Funktionäre kaum Toleranz gegenüber dem, was sie als „jüdischen Nationalismus“ betrachteten, selbst in Bewegungen wie dem „Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund“ (gemeinhin als „der Bund“ bezeichnet) der seinerseits dem Zionismus ablehnend gegenüberstand. Während der rassische Antisemitismus unterschiedslos alle Juden ins Visier nahm, folgte der sowjetische politische Antisemitismus einer trennenden Logik, die zwischen „guten“ und „schlechten“ Juden unterschied. Zur letzteren Kategorie zählten sogenannte „nationalistische“ oder „zionistische“ Juden, Zuschreibungen, die in der Praxis häufig willkürlich und opportunistisch erfolgten. Bruno Chaouat hat ein ähnliches Muster in Strömungen des zeitgenössischen Neomarxismus identifiziert, in denen jüdische Identität ebenfalls auf zwei gegensätzliche Archetypen reduziert wird: den „universalistischen, antistaatlichen Juden“ und den „partikularistischen, zionistischen Juden“. Paradoxerweise gilt in diesem Rahmen gerade derjenige als wahrhaft authentischer Jude, der den jüdischen Partikularismus transzendiert; der „nichtjüdische Jude“, in Isaac Deutschers berühmter Formulierung.Bruno Chaouat: Is Theory Good for the Jews? French Thought and the Challenge of the New Antisemitism, Liverpool 2016, XIX f. Für Deutschers Originalaufsatz s. Isaac Deutscher: The Non-Jewish Jew and Other Essays, hg. von Tamara Deutscher, London 2017, 30–42.
Unter den verschiedenen Kräften, die zu dieser „Spaltung der Juden“ im 20. Jahrhundert beitrugen, trat die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) als ein zentraler Akteur hervor.Zur Beziehung der DDR zu Israel s. Jeffrey Herf: Undeclared Wars with Israel: East Germany and the West German Far Left, 1967–1989, York u. a. 2016. Besonders relevant ist hier die Rolle, die diese ideologische Teilung bei der Bestimmung dessen spielte, was als authentischer und legitimer Ausdruck von Jüdischkeit in der Musik galt. Die spezifische Form des sowjetischen und ostdeutschen Antisemitismus hatte zudem greifbare persönliche Konsequenzen für jüdische Musiker, vor allem während und nach dem Sechstagekrieg, als das Politbüro weitgehend erfolglos versuchte, jüdische Intellektuelle zu einer öffentlichen Verurteilung der „israelischen Aggression und der Israel-Washington-Bonn-Verschwörung“ zu drängen.Jeffrey Herf: Undeclared Wars with Israel: East Germany and the West German Far Left, 1967–1989, New York u. a. 2016, 51. Jüdische Musik oder Musik von jüdischen Komponisten war in der DDR an sich niemals per se problematisch. Die offizielle Linie, in ästhetischen Fragen häufig ambivalent und inkonsistent, verlangte jedoch, dass diese musikalische Tätigkeit der politisierten staatlichen Vorstellung von Juden und Judentum entsprach.In der DDR und anderen Staaten des Ostblocks unterlagen auch andere kulturelle und musikalische Praktiken vergleichbaren Maßnahmen und Einschränkungen. Zur Volksmusik im Kommunismus s. Ulrich Morgenstern: Communism and Folklore Revisited: Russian Traditional Music and the Janus-faced Nature of Soviet Cultural Politics, in: Interdisciplinary Studies in Musicology 22 (2022), 63–80. In der Praxis hing eine solche Konformität jedoch weniger von klaren musikalischen Kriterien der Form oder Gattung ab – es sei denn, sie waren offen modernistisch oder regierungskritisch – als vielmehr von der Fähigkeit der Künstler, die Behörden von ihrer ideologischen Loyalität zu überzeugen.
Israelische Musik im ostdeutschen Rundfunk
Angesichts der antiisraelischen Haltung der DDR überrascht es nicht, dass israelische Musik unter den verschiedenen Zweigen jüdischer Musik in der kulturellen Landschaft des Landes am schwächsten vertreten war. Öffentliche Aufführungen und Rundfunkübertragungen israelischer Kompositionen waren selten, wenngleich nicht gänzlich abwesend. In den frühen 1960er Jahren nahm das Berliner Rundfunkorchester unter der Leitung von Konrad Mann, einem in Wien geborenen Dirigenten und Komponisten, der seit 1959 in Ostdeutschland tätig war, mehrere Werke der israelischen Kunstmusik auf.Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670. Vor seiner Ankunft dort lebte Mann in Israel, wo er verschiedene Ensembles und Chöre dirigierte und leitete, darunter den der Kommunistischen Partei Israels angeschlossenen Ron-Chor. In Ostdeutschland arbeitete er zunächst als Assistent von Franz Konwitschny in Berlin und war von 1961 bis 1965 Dirigent der Suhler Philharmonie.Ingward Ullrich: Hildburghäuser Musiker. Ein Beitrag zur Musikgeschichte der Stadt Hildburghausen, Hildburghausen 2003, 194. Im Sommer 1960 organisierte Mann ein Konzert mit seinen Bearbeitungen von Liedern von Widerstandskämpfern aus dem Wilnaer Ghetto und dem Konzentrationslager Treblinka. Wie in Musik und Gesellschaft berichtet wurde, rief die Aufführung eine tiefgreifende emotionale Reaktion beim Publikum hervor. Angesichts der damals in Köln beginnenden Welle antisemitischer Schmierereien und in Übereinstimmung mit der antifaschistischen Erzählung der DDR wurde die politische Bedeutung des Konzerts als Kritik an Westdeutschland gerahmt:
„Erschüttert fühlten die Zuhörer die Anklage und die Lebenssehnsucht der vom Faschismus gequälten und gehetzten jüdischen Menschen. Wohl jedem Anwesenden ist beim Anhören der beiden hervorragend interpretierten und in jiddischer Sprache vorgetragenen Lieder nochmals die Ungeheuerlichkeit des faschistischen Rassenterrors, der leider in Westdeutschland wieder fruchtbaren Boden zu seiner Entfaltung findet, zum Bewußtsein gekommen.“Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670, 668.
Wie noch zu zeigen sein wird, nahmen jiddische Lieder in der ostdeutschen jüdischen Musikkultur einen zentralen Stellenwert ein, nicht zuletzt aufgrund ihrer historischen Verbindung mit der jüdischen Arbeiterbewegung in Osteuropa. Demgegenüber war die Entstehung der frühen israelischen Kunstmusik eng mit dem Projekt verbunden, eine nationale, hebräisch geprägte Kultur im historischen jüdischen Heimatland zu schaffen. Zwischen diesen beiden Paradigmen jüdischer Identität bevorzugten ostdeutsche Funktionäre überwiegend das erstere, da es eher mit dem sozialistischen Internationalismus in Einklang stand und sich der von ihnen als „bürgerlicher Nationalismus“ betrachteten Ideologie der zionistischen Bewegung entgegenstellte.Zum Zionismus aus der Sicht des ostdeutschen politischen Establishments s. Angelika Timm: Views on Zionism and Israel in East Germany, in: Shofar 18/3 (2000), 93–109.
Vor diesem Hintergrund erhält Manns Einsatz für die israelische Kunstmusik eine besondere Bedeutung in der Geschichte des ostdeutschen Musiklebens. Seine Aufnahmen umfassten Werke von Komponisten wie Paul Ben-Haim und Marc Lavry, deren Musik die Wiederbelebung jüdischen Lebens in Erez Israel verkörperte und feierte.Ich danke dem Deutschen Rundfunkarchiv, Zentrale Information, für zusätzliche Informationen zu diesen Aufnahmen, die im Rahmen einer E-Mail-Korrespondenz am 8. Mai 2012 zur Verfügung gestellt wurden. Ebenso aufschlussreich ist die Rezeption dieser Aufnahmen. Im selben, oben zitierten Artikel in Musik und Gesellschaft bespricht Rosemarie Frank Menachem Avidoms 1. Sinfonie (Sinfonia Amamit), ein Werk, das in hohem Maße repräsentativ für den mediterranen Stil ist. Sie hebt den folkloristischen Charakter der Sinfonie und ihre Einbeziehung vielfältiger musikalischer Elemente hervor, von lyrischen israelischen Volksliedern und jemenitischen Melodien bis hin zur rhythmischen Vitalität des Hora-Tanzes und chassidischen Weisen.Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670, 669 f. Besonders bemerkenswert ist Franks Lob des nationalen Charakters der Sinfonie, den sie als „eine echte Volkssinfonie – erfüllt von dem festen Glauben an die nicht zu bezwingende Kraft und Urwüchsigkeit eines Volkes“.Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670, 670.
Obwohl Frank diesen Zusammenhang nicht ausdrücklich formulierte, deutet ihre Sprache auf Affinitäten zwischen der israelischen Kunstmusik und dem sowjetischen Konzept einer (sozial-)nationalen Musik hin.Zum Sozialistischen Realismus im Kontext der Musik der Sowjetrepubliken s. Marina Frolova-Walker: “National in Form, Socialist in Content”: Musical Nation-Building in the Soviet Republics, in: Journal of the American Musicological Society 51 (1998), 331–371. Tatsächlich weisen frühe israelische Kompositionen wie Avidoms Werk auffällige Parallelen zur Ästhetik des Sozialistischen Realismus auf, die die DDR unter sowjetischem Einfluss, mit lokalen Variationen, übernahm. Diese Ähnlichkeiten zeigen sich in einer verständlich gehaltenen Faktur, einer publikumsnahen und melodisch klar konturierten Klangsprache, in volkstümlichen Intonationen, in überwiegend konventionalisierten und leicht erfassbaren Formmodellen sowie in einer ausgeprägten Neigung zu einem optimistischen, zukunftsgerichteten Ton.Vgl. David G. Tompkins: Composing the Party Line: Music and Politics in Early Cold War Poland and East Germany, West Lafayette, Indiana 2013 (= Central European Studies), 19. In anderer Hinsicht wich der mediterrane Stil jedoch häufig von den etablierten Formen der westlichen klassischen Musik ab, indem er eher impressionistische Harmonien oder komponierte Heterophonie verwendete als ein aus dem Dur-Moll-System abgeleitetes tonales Vokabular. Dieser Wandel spiegelte die bewusste Ablehnung jener musikalischen Idiome wider, die mit der europäischen Diasporakultur assoziiert wurden, bei gleichzeitiger Hinwendung zu einem kollektivistischen, „realistischen“ Ansatz. In diesem Kontext lässt sich Avidoms zionistisch-realistische Sinfonie, wenn man sie so bezeichnen möchte, als musikalischer Ausdruck eines authentischen proletarischen Nationalbewusstseins verstehen, eine Möglichkeit, die sowjetische Führung seit der Ära Lenins und Stalins der jüdischen Kollektividentität konsequent abgesprochen hatte.Vgl. Angelika Timm: Views on Zionism and Israel in East Germany, in: Shofar 18/3 (2000), 93–109. Bezeichnenderweise übersetzte Frank den Titel von Avidoms Sinfonie, der ursprünglich keinen expliziten Bezug auf Israel enthielt, als „Israelische Volkssinfonie“.Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670, 669.
Manns Aufnahmen und die positive Resonanz, die sie in Musik und Gesellschaft fanden, erscheinen umso bemerkenswerter vor dem Hintergrund der sich Mitte der 1960er Jahre verschärfenden antiisraelischen Rhetorik der DDR, als das Regime in Reaktion auf die Hallstein-Doktrin engere Beziehungen zu arabischen und blockfreien Staaten anstrebte. Während der antiisraelischen Kampagnen von 1967 gehörte Mann zu den jüdischen Intellektuellen und Künstlern, die berufliche Sanktionen erlitten, weil sie sich weigerten, eine öffentliche antiisraelische Haltung einzunehmen. In der Folge wurde er von seinem Posten an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ entlassen.Eine E-Mail von Manns Tochter, die zu dieser Frage Auskunft gibt, ist im folgenden Blogeintrag wiedergegeben: https://onegshabbat.blogspot.com/2012/11/blog-post_29.html (1. 1. 2025). Seine israelische Staatsbürgerschaft und seine Bemühungen, israelische Musik zu fördern, dürften das Misstrauen des Regimes ihm gegenüber zusätzlich verstärkt haben.
Sozialistischer Realismus als antifaschistische Ästhetik
Ostdeutsche Komponisten jüdischer Herkunft integrierten Aspekte jüdischer Erfahrung in ihre musikalischen Werke, während sie zugleich die Ästhetik des Sozialistischen Realismus und die offiziellen historischen Narrative des Staates vollständig übernahmen. Ernst Hermann Meyers Mansfelder Oratorium (1950) exemplifiziert diesen Ansatz, indem es den Aufstieg des Nationalsozialismus und den Holocaust thematisiert und diese Ereignisse in den Gründungsmythos des Antifaschismus in der DDR einbettet.Zum nationalen Mythos des Antifaschismus in der DDR s. Alan L. Nothnagle: Building the East German Myth: Historical Mythology and Youth Propaganda in the German Democratic Republic, 1945–1989, Ann Arbor 2002, 93 ff. Das Oratorium entfaltet eine weitgespannte historische Erzählung, die das Schicksal der Mansfelder Bergarbeiter vom Mittelalter bis zur Etablierung des Staatssozialismus in Ostdeutschland nachzeichnet. Beim Schreiben des Librettos stützte sich Stephan Hermlin in hohem Maße auf die Grundsätze des historischen Materialismus und auf die Interpretation des Faschismus in der sowjetischen Geschichtsschreibung. Meyers Musik mit ihren neobarocken und neoklassischen Elementen stützt diese ideologische Perspektive, indem sie zentrale Ereignisse und Figuren markiert und hervorhebt. Dadurch wird das Werk in sozialistischen ästhetischen Konventionen sowie in der antifaschistischen Historiografie der DDR verankert.Vgl. Golan Gur: Classicism as Anti-Fascist Heritage: Realism and Myth in Ernst Hermann Meyer’s Mansfelder Oratorium (1950), in: Kyle Frackman und Larson Powell (Hg.): Classical Music in the German Democratic Republic: Production and Reception, Rochester 2015 (= Studies in German Literature, Linguistics, and Culture), 34–57.
Das Problem dieses geschichtsphilosophischen Diskurses liegt nicht nur in seiner Marginalisierung der spezifisch jüdischen Erfahrung des Holocaust, sondern auch in seiner Rolle bei der „Universalisierung“ des Faschismusbegriffs. In der Verwendung durch SED-Funktionäre wurde „Faschismus“ und implizit der Antisemitismus primär als Produkt des Kapitalismus und der gescheiterten Revolution von 1918/1919 gedeutet und nicht als eigenständiges Phänomen mit eigenen ideologischen Grundlagen.M. Rainer Lepsius: Die Teilung Deutschlands und die deutsche Nation, in: ders.: Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1993 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 100), 196–229, 227. Nach Mario Rainer Lepsius führte diese Universalisierung dazu, den Nationalsozialismus aus der ostdeutschen Geschichtserzählung zu entfernen. Stattdessen fungierte die NS-Vergangenheit als moralischer Bezugspunkt, um diese Geschichte auf die Bundesrepublik Deutschland zu projizieren und Entwicklungen dort zu verurteilen.M. Rainer Lepsius: Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des „Großdeutschen Reiches“, in: ders.: Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1993 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 100), 229–245, 232. Innerhalb dieses Rahmens verkörpert Meyers Oratorium eine solche Universalisierung sowohl musikalisch als auch als historisch-literarisches Konstrukt, indem es spezifisch jüdische Erfahrungen in die offizielle ostdeutsche Erzählung vom antifaschistischen Widerstand eingliedert.
Obwohl dieser Ansatz dominant blieb, thematisierten einige ostdeutsche Kompositionen jüdische Inhalte auf eine Weise, die in unterschiedlichem Maße den offiziellen Narrativen widersprach. Die gemeinsam komponierte Kantate Jüdische Chronik ragt in dieser Hinsicht hervor, da sie ost- und westdeutsche Perspektiven miteinander verbindet und das Leid der Juden als Opfer des Antisemitismus in den Vordergrund stellt. Dadurch verlagert sie den Fokus von politischer Verfolgung auf rassifizierte Unterdrückung. Paul Dessau, Initiator und Mitkomponist des Werkes, war selbst Jude und hatte sowohl Synagogenmusik als auch andere Kompositionen mit jüdischer Thematik geschrieben. Dazu zählen seine Haggadah Shel Pesach nach einem Text von Max Brod sowie seine Musik zu dem Dokumentarfilm Avodah (hebräisch für „Arbeit“) der die Leistungen zionistischer Pioniere im britischen Mandatsgebiet Palästina feiert.Zum Film „Avodah“ s. Ofer Ashkenazi: The Symphony of a Great Heimat: Zionism as a Cure for Weimar Crisis in Lerski’s Avodah, in: Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational, hg. von Jay Howard Geller und Leslie Morris, Ann Arbor 2016, 91–122. Diese Werke stammen aus einer frühen Schaffensphase Dessaus, in der er offenbar mit zionistischen Idealen sympathisierte. Während seiner Jahre im Exil jedoch näherten sich seine politischen Überzeugungen zunehmend dem Kommunismus an, eine Entwicklung, die ihn schließlich veranlasste, sich nach dem Krieg in der Sowjetischen Besatzungszone niederzulassen.
Anlass zur Komposition des später als Jüdische Chronik bekannt gewordenen Werks waren antisemitische Vorfälle in Westdeutschland in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren.Joy H. Calico: “Jüdische Chronik”: The Third Space of Commemoration between East and West Germany, in: The Musical Quarterly 88 (2005), 95–122. Das Projekt nahm seinen Ausgang in Dessaus Korrespondenz mit Jens Gerlach, dem Autor des Textes, und weitete sich bald zu einer Zusammenarbeit aus, an der in Ostdeutschland Rudolf Wagner-Régeny sowie in Westdeutschland Boris Blacher und Karl Amadeus Hartmann beteiligt waren, ebenso wie Hans Werner Henze, der damals in Italien lebte. Dessau komponierte den fünften Abschnitt, den Epilog, und arbeitete mit Henze am vierten. Obwohl die Kantate 1961 vollendet war, wurde ihre Uraufführung mehrfach verschoben, zunächst aufgrund von Protesten westdeutscher Musiker gegen den Bau der Berliner Mauer. Dessau beabsichtigte offensichtlich, die Aufführung mit den abschließenden Phasen des Eichmann-Prozesses in Jerusalem zusammenfallen zu lassen, um das öffentliche Bewusstsein für Antisemitismus und NS-Verbrechen zu schärfen.Silvia Schlenstedt: Die Kollektivkomposition Jüdische Chronik (1960–1961), in: Helmut Peitsch (Hg.) in Verbindung mit Konstantin Baehrens u. a.: Nachkriegsliteratur als öffentliche Erinnerung. Deutsche Vergangenheit im europäischen Kontext, Berlin und Boston [2019], 394–406, 400. In Gerlachs Text fungiert der Aufstand im Warschauer Ghetto als zentrales historisches Ereignis, dessen Aktualität durch direkte Bezüge zur Gegenwart unterstrichen wird („dies geschieht heute“). Nach dem Prolog schildern der zweite und dritte Abschnitt den Alltag im Ghetto, während der vierte den Aufstand selbst darstellt. Die Kantate erreicht Kohärenz durch ihre narrative Struktur, die Instrumentation und den konsequenten Einsatz von Ton- und Intervallmaterial, das von einer einzigen Zwölftonreihe abgeleitet ist.Joy H. Calico: “Jüdische Chronik”: The Third Space of Commemoration between East and West Germany, in: The Musical Quarterly 88 (2005), 95–122, 101.
Dessaus Verwendung der Zwölftontechnik, die in der DDR damals noch eine unkonventionelle Wahl darstellte, lädt zu einem Vergleich mit Schönbergs A Survivor from Warsaw ein. Beide Werke zentrieren die Ereignisse des Warschauer Ghettos und bedienen sich einer ausgeprägt modernistischen musikalischen Sprache als ästhetischer Intervention, die der tragischen Schwere des Holocaust entspricht. In ihrer Behandlung des Judentums unterscheiden sie sich jedoch erheblich. Schönberg strukturierte den Schlussteil von A Survivor from Warsaw um das Schma Jisrael, das grundlegende Bekenntnis des jüdischen Monotheismus, und verlieh der politischen Botschaft des Werkes damit eine deutlich religiöse Dimension. Demgegenüber sind ausdrücklich religiöse Elemente in der Jüdischen Chronik weitgehend abwesend.Joy H. Calico: “Jüdische Chronik”: The Third Space of Commemoration between East and West Germany, in: The Musical Quarterly 88 (2005), 95–122, 107. Dennoch widersetzte sich Dessaus Kantatenprojekt auf seine Weise den ästhetischen und ideologischen Erwartungen. Obwohl die ostdeutsche Presse das Werk vor allem als Reaktion auf antisemitische Vorfälle in Westdeutschland einordnete, macht seine ausdrückliche Fokussierung auf Antisemitismus als spezifisch jüdische Erfahrung, verbunden mit der Verwendung von Schönbergs Zwölftontechnik, es zu einem außergewöhnlichen musikalischen Denkmal für den Holocaust in der Nachkriegszeit.
Zwischen Modernismus und Synagoge
Die Art und Weise, wie die Beziehung zwischen Schönbergs kompositorischen Verfahren und seinen philosophisch-religiösen Überzeugungen in der DDR gedeutet wurde, verdient in diesem Zusammenhang nähere Betrachtung. In den frühen Jahrzehnten der DDR wurden seine dodekaphone Musik und die Atonalität im weiteren Sinne regelmäßig als Inbegriff künstlerischen „Formalismus“ denunziert. Solche Musik galt den Kulturfunktionären als unvereinbar mit dem Sozialistischen Realismus und wurde, wenn überhaupt, nur dann geduldet, wenn sie dazu bestimmt war, negative Emotionen oder verstörende Bilder zu evozieren. Die Spannung zwischen den ästhetischen Erwartungen des SED-Regimes und Schönbergs Modernismus wird jedoch komplexer, wenn man sie in Beziehung zu seiner jüdischen Identität betrachtet. Ostdeutsche Kritiker brachten seine kompositorische Praxis gelegentlich mit seiner Herkunft und seinen Erfahrungen als Jude in Verbindung. In einem Interview von 1975 erinnerte sich Ernst Hermann Meyer zustimmend an eine Passage aus seinem Buch Musik im Zeitgeschehen von 1952, in der er Schönberg und anderen Komponisten vorwarf, aus der Erfahrung der Verfolgung durch das NS-Regime nicht die seiner Ansicht nach angemessenen künstlerischen Konsequenzen gezogen zu haben. Statt die neue, optimistische Vision des Kommunismus aufzugreifen, wie sie in sozialistisch-realistischen Musikwerken zum Ausdruck komme, hätten sie sich in den Formalismus und die mystische Abstraktion spätbürgerlicher Ästhetik geflüchtet.Ernst Hermann Meyer: Kontraste, Konflikte: Erinnerungen, Gespräche, Kommentare, hg. von Dietrich Brennecke und Mathias Hansen, Berlin 1979, 241. Die ursprüngliche Passage findet sich in: Ernst H. Meyer: Musik im Zeitgeschehen, hg. von der Deutschen Akademie der Künste, Berlin 1952, 151.
Schönbergs künstlerische Auseinandersetzung mit dem Judentum, die religiöse, spirituelle und politische Themen umfasste, erwies sich in der Inszenierung und Aufführung seiner Werke als umstritten, selbst in Phasen relativer kultureller Öffnung in der DDR. Seine Oper Moses und Aron bot einen besonders aufschlussreichen Anlass, an dem sich diese Spannungen manifestierten, da ihr biblischer Stoff als potenziell unvereinbar mit der säkular-materialistischen Weltanschauung des Staates galt. Das Werk rückte während der Vorbereitungen für seine Dresdner Premiere 1975 ins Zentrum der Auseinandersetzungen. Bereits im Genehmigungsverfahren sah sich Harry Kupfer, Operndirektor am Staatstheater Dresden, politischen Vorbehalten gegenüber und musste das Ministerium für Kultur davon überzeugen, dass die Inszenierung einem „sozialistischen Theaterkonzept“ entsprechen würde.Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 228. Dabei stand nicht nur, ja nicht einmal in erster Linie, Schönbergs ikonoklastisches musikalisches Idiom zur Debatte, sondern vor allem der religiös-nationale Gehalt der Oper und die Herausforderung, ihn in mit dem Marxismus vereinbare Kategorien zu überführen. In öffentlichen Stellungnahmen und in der Korrespondenz mit ostdeutschen Behörden vertraten Kupfer und Horst Seeger, der Leiter der Dresdner Oper, die Auffassung, die religiösen Elemente des Werkes seien als Ausdruck von Schönbergs Humanismus zu verstehen.
Die Inszenierung spiegelte diese Lesart wider, indem sie die Israeliten als ein unterdrücktes Volk darstellte, das sich um die Verwirklichung „menschenbefreienden Idee[n]“ bemüht.Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 230. Ein Entwurf des Inszenierungskonzeptes unterstrich diese Interpretation und verankerte sie in Schönbergs Auseinandersetzung mit Imperialismus und Kapitalismus:
„Die Erkenntnis, dass eine menschenwürdige Existenz und eine lebenswerte Zukunft unter den imperialistischen Bedingungen der Unterdrückung und Ausbeutung ganzer Völker nicht mehr denkbar sind, veranlaßte den Komponisten, die Frage, ‚Wie soll der Mensch leben?‘ auf neue Weise zu stellen. In der kompromißlosen Auseinandersetzung mit der ihn umgebenden kapitalistischen Welt- und Lebensordnung und auf der Suche nach einem Weg aus deren unmenschlichen Grenzen heraus, schuf Arnold Schönberg ein Werk, das sich uns heute als eine der wesentlichsten Kettenglieder in der Reihe der progressiven Traditionen künstlerisch-kritischer Bemühungen weltanschaulichen Charakters zwischen dem bürgerlich-klassischen und dem sozialistischen Humanismus auf dem Gebiet des musikalischen Theaters darstellt.“Zitiert in: Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 230 f.
Diese materialistische Deutung prägte auch die Darstellung der Hauptfiguren, insbesondere Moses. Wie Julia Glänzel feststellt, zeigte die Inszenierung Moses nicht als religiöse Figur, sondern als visionären politischen Denker, der für eine soziale Utopie eintritt.Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 230. In dieser Lesart erscheint Moses, der Prophet und Führer des jüdischen Volkes, als Teil einer Genealogie sozialer Revolutionäre. Kupfer formulierte dies in einem Interview von 1988 ausdrücklich:
„Wenn man das etwas weiter fassen will, haben wir auf der einen Seite den theoretischen Ideologen, der die Utopie oder Herausforderung an Zukünftiges entwirft, ob wir da Moses nehmen, Lenin oder Marx, oder wen auch immer. Das Problem liegt in der Verwirklichung dieser Idee der Realität, und zwar bei jeder Ideologie, bei jeder politischen Richtung immer wieder. Diese Widersprüche gibt es ja in jeder Epoche, ein dauerndes Spannungsverhältnis, ein Annähern, ein Ringen – das ist die Bewegung der Entwicklung. Diese Frage wird in ‚Moses und Aron‘ behandelt. Es ist ein ewiger Stoff.“Zitiert in: Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 229.
In der Gestalt eines „biblischen Marx“ erscheint Moses als Personifikation des Strebens nach einer neuen kollektiven Lebensform, die auf einem Ethos der Selbstlosigkeit beruht; eine Art alttestamentarischer Proto-Kommunismus.Siehe auch Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 234. Diese Interpretation von Moses und Aron war jedoch keineswegs repräsentativ für die gesamte Rezeption der Oper in der DDR. Vielmehr überschneidet sie sich mit einer breiteren Tendenz, die sich seit den 1970er Jahren herausbildete und darauf abzielte, Neue Musik in die Kulturlandschaft zu integrieren, parallel zu Bemühungen, die sozialistische Ästhetik in Theorie und Praxis zu liberalisieren und zu erweitern.
Frühere ostdeutsche Kommentatoren hatten Moses und Aron dagegen als Ausdruck einer Weltanschauung betrachtet, die grundlegend im Widerspruch zu Sozialismus und progressiver Politik stehe. In einem 1957 anlässlich der Zürcher Uraufführung verfassten Text näherte sich Eberhard Rebling der Oper aus der Perspektive einer rigiden, sozialistisch-realistischen marxistischen Kritik. In Übereinstimmung mit Ernst Hermann Meyer deutete er Schönbergs Hinwendung zu religiösen Themen als ein Zeichen der Resignation gegenüber der „Aufgabe, sich den Widersprüchlichkeiten des Lebens unserer Zeit Herr zu werden“.Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 465. Gleichwohl erkannte er in Moses und Aron eine aufrichtige Wahrheitssuche, die seiner Ansicht nach jedoch durch die bürgerliche Ideologie begrenzt blieb. Besonders aufschlussreich war für Rebling Schönbergs Darstellung des Volkes in der Szene des Tanzes um das Goldene Kalb („Orgie der Vernichtung und des Selbstmordes“) in der er Schönbergs Skepsis gegenüber der Vorstellung erkannte, „die Menschen [vermögen] ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“, eine Haltung, die er mit dem Ideal des Kommunismus für unvereinbar hielt.Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 465 f. Zur Episode des Goldenen Kalbs s. Yoel Greenberg: “These Are Your Gods, Oh Israel”: Chosenness in Schoenberg’s “Moses und Aron” as a Response to Houston Stewart Chamberlain’s “Foundations”, in: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 48 (2017), 71–99. In seiner Kritik wird dieses Ideal und dessen künstlerischer Ausdruck weniger mit Schönbergs Judentum kontrastiert als mit einer ästhetischen Position, die „in der Wirklichkeit nichts Schönes mehr erblicken“ könne und in der „Wahrhaftigkeit und Schönheit als unvereinbare Extreme [auseinanderklaffen]“.Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 467. Er lobt die bemerkenswerte Übereinstimmung zwischen den intellektuellen und musikalischen Elementen der Oper, hält jedoch daran fest, dass eine solche Synthese nur deshalb möglich sei, weil der weltanschauliche Rahmen „bürgerlichen Idealismus mit theologischer Askese, moderne Metaphysik mit alttestamentlichem Symbolismus“ konfrontiere.Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 465.
Aus seiner Perspektive korrespondieren Schönbergs musikalische Technik und sein Material mit dem national-religiösen Gehalt der Oper nicht primär deshalb, weil sie dem Gegenstand besonders angemessen wären, sondern weil sie die Widersprüche der bürgerlichen Weltanschauung und deren Unfähigkeit widerspiegeln, sich „eine neue, schönere Welt“ vorzustellen.Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 467. Wie noch zu zeigen sein wird, war Rebling ein engagierter Förderer jüdischer Musik in der DDR, und sein enges persönliches und berufliches Verhältnis zum Judentum und zur jüdischen Kultur, obwohl er selbst nicht jüdisch war, dürfte seine Interpretation von Moses und Aron beeinflusst haben. Seine Rezension legt nahe, dass er Ausdrucksformen jüdischen religiösen oder nationalen Bewusstseins an sich weder als rechtfertigungsbedürftig noch als tadelnswert betrachtete. Selbst Schönbergs „Flucht in den Gottesglauben“ wird nicht als eine erneute Bekräftigung der jüdischen Identität des Komponisten gedeutet, sondern als Symptom spätbürgerlicher Ideologie.
Reblings Zurückhaltung, sich mit der jüdischen Dimension der Oper als eigenständigem Aspekt auseinanderzusetzen, mag, ob bewusst oder unbewusst, auch anderen Überlegungen geschuldet gewesen sein. Erstens konzentrierte sich seine eigene Beschäftigung mit jüdischer Kultur auf die Volksmusik, die er möglicherweise als klareren musikalischen Ausdruck des Judentums ansah. Zweitens dürfte eine intensivere Auseinandersetzung mit jüdischen Motiven in Moses und Aron erst dann relevant geworden sein, als sich in den 1970er Jahren die Perspektive einer ostdeutschen Inszenierung abzeichnete. Wie dem auch sei, zu diesem Zeitpunkt waren Erscheinungsformen von Jüdischkeit in der Musik dem ostdeutschen Publikum bereits aus dem liturgischen Repertoire vertraut. Obwohl diese Musik ausdrücklich religiöse Themen behandelte, schien sie nicht dieselben ästhetischen oder ideologischen Herausforderungen zu stellen wie die avantgardistischen Werke etwa Schönbergs.
Im Bereich der Synagogenmusik nimmt der Beitrag Werner Sanders zum jüdischen Musikleben in der DDR eine besonders bedeutende Stellung ein.Zu Werner Sander s. Tina Frühauf: Werner Sander „den Frieden endgültig zu festigen“. Ein großer Vertreter der jüdischen Musik in der DDR, Berlin 2017 (= Jüdische Miniaturen 213), sowie dies.: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021, 194 ff. In eine säkulare jüdische Familie hineingeboren und klassisch-musikalisch ausgebildet, begann Sanders nachhaltiges Engagement für jüdische musikalische Aktivitäten, über seine frühere Mitwirkung in einem lokalen Synagogenchor hinaus, bereits in seiner Heimatstadt Breslau, nach der Machtergreifung und der Einführung antijüdischer Gesetze. Nach dem Krieg arbeitete er als Lehrer und Musikdirektor in Meiningen, bevor er Kantor und Leiter des Synagogenchores in Leipzig wurde, als Nachfolger von Barnet Licht.Tina Frühauf: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021, 194. Sanders Wirken als Kantor in jüdischen Gemeinden in Ostdeutschland, vor allem in Leipzig, Dresden, Erfurt und Halle, spielte eine zentrale Rolle beim Knüpfen von Verbindungen zwischen diesen Gemeinden und bei der Pflege ihres kulturellen Zusammenhalts.Tina Frühauf: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021, 210. Obwohl er keiner bestimmten Denomination angehörte, orientierte sich seine musikalische Praxis an den reformistischen Traditionen Salomon Sulzers und Louis Lewandowskis. Er arbeitete zudem mit jüdischen und nichtjüdischen Ensembles zusammen, insbesondere mit dem Leipziger Oratorienchor, in Aufführungen vokaler Kunstmusik, etwa von Oratorien Georg Friedrich Händels, Joseph Haydns und Felix Mendelssohn Bartholdys.Tina Frühauf: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021, 200.
Obwohl die jüdische liturgische Musik dem allgemeinen System staatlicher Kulturaufsicht in der DDR unterlag, scheint sie vergleichsweise wenig Kontroversen ausgelöst zu haben. Ihre Vereinbarkeit mit der Präferenz des Sozialistischen Realismus für traditionelle Musikstile sowie die Tendenz des Regimes, das Judentum primär als Religion zu behandeln, dürften ihre Akzeptanz erleichtert haben. Gleichwohl waren dieses Repertoire und die Aktivitäten zu seiner Wiederetablierung nicht frei von politischen Implikationen. Diese ergaben sich weniger aus offenem Widerstand gegen oder Zustimmung zu staatlicher Ideologie als aus den inhärenten Herausforderungen des Wiederaufbaus jüdischen Musiklebens im Nachkriegsdeutschland.
Sanders musikalische Tätigkeit in der Nachkriegszeit, obgleich in historischen deutsch-jüdischen liturgischen und paraliturgischen Repertoires verwurzelt, entfaltete sich in einer drastisch veränderten sozialen Landschaft, die von äußerst kleinen und fragmentierten jüdischen Gemeinden geprägt war. Diese Situation wurde noch dadurch verschärft, dass unter den überwiegend säkularen, deutschsprachigen Juden, die aus Sympathie für kommunistische Ideale nach Ostdeutschland (re)migriert waren, ein generelles Desinteresse an religiöser Praxis herrschte. Unter diesen Bedingungen nahm die Wiederbelebung jüdischer Musik, insbesondere der sakralen Musik, den Charakter dessen an, was Diana Pinto und Y. Michal Bodemann als einen universalisierten, musealen „jüdischen Raum“ im Nachkriegseuropa beschreiben: einen Raum, der weniger durch die erneuerte Präsenz und Partizipation von Juden als durch die Prioritäten des kulturpolitischen Mainstreams definiert ist.Ruth Ellen Gruber: Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe, Berkeley 2002, 10 f. Zusammengenommen erklären diese Faktoren, weshalb Ostdeutschland kein bedeutendes Zentrum jüdisch-religiösen Kulturlebens werden konnte. In einem anderen Bereich jedoch nahm das Land eine führende Rolle in der tatsächlichen Revitalisierung jüdischer Musiktradition ein, nämlich im jiddischen Lied.
Jiddischismus und die zerbrochene Utopie
Diese Leistung wurde vor allem durch die Sängerin und Tänzerin Lin Jaldati ermöglicht, deren Einsatz für die Wiederbelebung jiddischer Kultur nach dem Krieg von entscheidender Bedeutung war. Ebenso maßgeblich, wenn auch häufig unterschätzt, war der Beitrag ihres Ehemannes Eberhard Rebling, der sie nicht nur am Klavier begleitete, sondern durch seine Tätigkeit als Musikwissenschaftler auch zur Bewahrung und Ausweitung der Präsenz jiddischer Musikkultur beitrug. Auf der Grundlage ihrer umfassenden Kenntnisse und ihrer tiefen Verankerung in jiddischer Sprache, Musik und Poesie boten Jaldatis künstlerische Programme eine lebendige Vergegenwärtigung jüdischen Erbes, die sich deutlich von den statischen, musealen Vermittlungsformen unterschied, welche einen Großteil der öffentlichen jüdischen Kultur im Nachkriegseuropa prägten.
Als Rebekka Brilleslijper in Amsterdam geboren, begann Jaldati ihre künstlerische Laufbahn in ihrer Heimatstadt. In ihrer Jugend war sie in der sozialistisch-zionistischen Bewegung „Hashomer Hatzair“ aktiv, wo sie sowohl mit hebräischen als auch mit jiddischen Liedern in Berührung kam.Die biografischen Angaben hier stammen größtenteils von David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154). Da sie zur Unterstützung ihrer Familie beitragen musste, verließ sie im Alter von zwölf Jahren die Schule. Während sie als Näherin arbeitete, nahm sie Tanzunterricht, erlangte rasch den Ruf einer talentierten Künstlerin und wurde schließlich Mitglied der Nationalen Revue. Durch ihre Verbindung mit dem Fotografen Boris Kowadlo engagierte sie sich zunehmend in sozialistischen Kreisen und begann, als Interpretin jiddischer Lieder aufzutreten.David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154), 9 f. 1937 lernte sie Rebling kennen, der im Jahr zuvor aus Berlin ins Exil geflohen war. Ab 1938 reisten sie durch Städte in den Niederlanden und präsentierten Programme, die jiddisches Liedrepertoire mit Tanzdarbietungen verbanden.David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154), 11 f. Nach der deutschen Besatzung der Niederlande tauchte das Paar unter, organisierte jedoch weiterhin geheime Konzerte. 1944 wurde ihr Versteck von deutschen Soldaten entdeckt, was zu Jaldatis Deportation zunächst nach Westerbork und später nach Auschwitz führte. Während ihrer Inhaftierung lernte sie Anne und Margot Frank kennen, eine Erfahrung, die später ihre künstlerische Arbeit beeinflusste. Nach dem Krieg vereinigte sie sich wieder mit Rebling und nahm, nach einer Phase der Genesung, ihre musikalische Tätigkeit wieder auf, trat für jüdische Zuhörer in Displaced-Persons-Lagern und für den Kulturbund in der Sowjetischen Besatzungszone auf.David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154), 16–22. 1952 ließen sie und Rebling sich mit ihren beiden Töchtern Kathinka und Jalda Rebling in Ostdeutschland nieder, die beide später professionelle Musikerinnen wurden und an Jaldatis musikalischen und theatralen Produktionen mitwirkten.
In der DDR etablierte sich Jaldati allmählich als führende Interpretin jiddischer Musik und erlangte internationale Anerkennung. Auch Rebling setzte seinen beruflichen Weg fort und baute ihn weiter aus. Neben seinen Auftritten als Pianist amtierte er als Rektor der Hochschule für Musik (die auf seine Initiative hin nach Hanns Eisler benannt wurde) sowie als Herausgeber der Zeitschrift Musik und Gesellschaft. Zudem gehörte er zu den wenigen ostdeutschen Wissenschaftlern, die zu jüdischen musikalischen Themen publizierten. 1966 veröffentlichten Jaldati und Rebling gemeinsam eine Anthologie jiddischer Lieder, die mehrere Auflagen erlebte. Sie enthält zahlreiche Stücke aus Jaldatis Repertoire und vermittelt wertvolle Einblicke in die Rezeption des jiddischen Liedes als Form jüdischer Selbstartikulation in der DDR.Lin Jaldati und Eberhard Rebling: Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, übers. von Heinz Kahlau, Berlin 1966.
In seinem Vorwort zu dieser Anthologie gibt Rebling einen historischen Überblick über die Entstehung des jiddischen Liedes als musikalisch-literarische Gattung. Nach einer Schilderung des Antisemitismus und der Vertreibung der Juden im Mittelalter hebt er die vielfältigen musikalischen Einflüsse hervor, die die Lieder des osteuropäischen Judentums prägten, von deutschen Volksliedern und slawischer Musik bis hin zu „Elemente[n] der ursprünglichen orientalischen Melodik“.Lin Jaldati und Eberhard Rebling: Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, übers. von Heinz Kahlau, Berlin 1966, 6. Ferner unterstreicht er die Bedeutung der chassidischen Bewegung innerhalb dieser Tradition, misst jedoch den Verbindungen der Lieder zu säkularen sozialen Bewegungen ein noch größeres Gewicht bei. Seiner Einschätzung nach markierten der Aufstieg der Arbeiterbewegung im späten 19. Jahrhundert und die Gründung des Bundes den Beginn einer neuen Epoche des jiddischen Liedes, einer Epoche, die von revolutionärer Energie und neuen Ausdrucksformen durchdrungen war. Er schreibt: „Das revolutionäre Pathos, der Haß gegen die Unterdrücker, die Gewißheit des zukünftigen Sieges, der kraftvolle Marschrhythmus und die Intonationen des Arbeiterliedes waren ganz neuartige, dem jiddischen Volkslied bisher unbekannten Elemente.“Lin Jaldati und Eberhard Rebling: Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, übers. von Heinz Kahlau, Berlin 1966, 12.

Im Einklang mit dieser Deutung rückt die Anthologie das Verhältnis zwischen dem jiddischsprachigen Judentum, der Arbeiterbewegung und dem Kampf gegen den Faschismus in den Mittelpunkt. Ein besonders eindrückliches Beispiel ist das Lied Zu ejns, zwej, draj (Abb. 2), das der Autor, Partisanenkämpfer und Liedersammler Shmerke Kaczerginski während seiner Haft im Ghetto von Wilna schrieb und auf die Melodie von Hanns Eislers und Bertolt Brechts Einheitsfrontlied setzte. Weitere Lieder der Anthologie bezeugen ebenfalls die engen Verflechtungen zwischen der jiddischen Liedtradition und dem Sozialismus, selbst dort, wo sie auf traditionelle Melodien zurückgreifen.
Man könnte annehmen, dieses Repertoire entspreche als Ausdruck einer sozialistischen jüdischen Identität ohne Weiteres den ideologischen Erwartungen der kommunistischen Parteiführung. Dies mag auch der Überzeugung früher Bundisten entsprochen haben, die die Idee eines jüdischen Nationalstaates zurückwiesen und stattdessen eine jüdische Kulturautonomie auf der Grundlage der jiddischen Sprache propagierten. Indem er Salomon (auch Sholem oder Schalom) Anski, den Autor der Bund-Hymne Di Shvue (Der Eid), zitiert, ruft Rebling die Vision und die Ideale dieser Bewegung auf: „Schon der große jüdische Dichter Schalom Anski […] hat in dem Lied ‚Mir wandern‘ kurz vor seinem Tod ein Bekenntnis zu einer ‚kommenden, neuen, größeren, schöneren und besseren Welt,‘ der Welt der Arbeiterklasse ausgesprochen.“Lin Jaldati und Eberhard Rebling: Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, übers. von Heinz Kahlau, Berlin 1966, 12. In der Realität jedoch war das Verhältnis des Bundes zur sowjetischen Führung alles andere als harmonisch. Stalin insbesondere weigerte sich, die Juden als Nation anzuerkennen, selbst im Sinne der vom Bund vertretenen „kulturellen Autonomie“, und verurteilte die Bewegung dafür, „spezifische, rein nationalistische Ziele“ zu verfolgen.J. V. Stalin: Marxism and the National Question (1913); online unter: https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a.htm (1. 1. 2025). Wie schon Lenin bestritt auch er die Legitimität jeder gesonderten jüdischen Identität, sei sie religiöser, nationaler oder kultureller Natur.V. I. Lenin: Critical Remarks on the National Question (1913); online unter: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/crnq/index.htm (1. 1. 2025). Aus dieser Perspektive lassen sich die musikalischen Aktivitäten Lin Jaldatis und Eberhard Reblings eher als Hinweis auf eine Tradition jüdischen Partikularismus verstehen, ungeachtet der engen historischen Verbindung der jiddischen Kultur mit dem Sozialismus und mit den jüdischen Gemeinschaften Osteuropas.
Die Rezeption des jiddischen Liedes als Medium jüdischer Identität, angesiedelt zwischen Universalismus und Partikularismus, entwickelte sich im Zuge späterer historischer Konstellationen weiter. Zwar löste sich der Bund in der Folge der bolschewistischen Revolution auf, doch ging sein Niedergang auch mit einem umfassenderen Wandel des jüdischen Lebens und seiner Wahrnehmung einher. Mit dem wachsenden Gewicht zionistischer Ideen und Institutionen sowie deren internationaler Anerkennung traten die hebräische Kultur und der Staat Israel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als dominante Symbole jüdischen nationalen Partikularismus hervor.Dennoch gibt es auch jiddische Musik, die von zionistischen Themen inspiriert ist. Vgl. Jascha Nemtsov: Der Zionismus in der Musik: Jüdische Musik und nationale Idee, Wiesbaden 2009 (= Jüdische Musik. Studien und Quellen zur jüdischen Musikkultur 6), 132 ff. Dies mag erklären, weshalb das spezifische Verständnis jüdischen Partikularismus im Sinne des Bundes in der DDR relativ wenig negative Aufmerksamkeit auf sich zog, abgesehen von Phasen antisemitischer Agitation, in denen alles „Jüdische“ der Gefahr ausgesetzt war, als Teil einer „kapitalistischen“ oder „zionistischen“ Verschwörung wahrgenommen zu werden.
Trotz Jaldatis unerschütterlicher Bindung an den Sozialismus war auch sie von solchen Anfeindungen nicht verschont. 1967 kam ihre Karriere, wie die anderer jüdischer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der DDR, abrupt zum Stillstand. Zwischen 1967 und 1974 erhielt sie nahezu keine offiziellen Einladungen mehr zu Auftritten in der DDR.Interview mit Lin Jaldati und Eberhard Rebling; online unter: https://archive.org/details/lin-und-eberhard-die-geschichte-einer-grossen-liebe-ed-stuhler-2013. Ein Transkript des Interviews ist verfügbar unter: https://assets.deutschlandfunk.de/FILE_803fa3499fc2c9bbba9cbee81c1c5b24/original.pdf (1. 1. 2025). Diese Marginalisierung jüdischer Künstler und Intellektueller, denen eine mögliche Sympathie für Israel oder den Zionismus unterstellt wurde, war eine unmittelbare Folge der antiisraelischen Kampagne, die auf den Ausbruch des Sechstagekrieges und Israels Sieg über sowjetisch unterstützte arabische Staaten folgte. Jaldatis erster größerer öffentlicher Auftritt nach dieser Phase fand 1975 bei den Berliner Festtagen statt.
Die Mitte der 1970er Jahre markierte sowohl Jaldatis berufliches Wiederaufleben als auch das Entstehen neuer künstlerischer Initiativen. Um 1977 hatte sie gemeinsam mit ihrer Tochter Jalda Rebling ein Programm erarbeitet, das der Erinnerung an den Holocaust und dem Vermächtnis Anne Franks gewidmet war.Dies war nicht der erste kulturelle Anlass, bei dem Lin Jaldati öffentlich mit Anne Frank in Verbindung gebracht wurde. Im April 1957 trug sie bei einer Gedenkveranstaltung zum Aufstand im Warschauer Ghetto jiddische Lieder vor, während Katharina Herberg Auszüge aus Anne Franks Tagebuch las. Dazu: Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 138. Die 1979 uraufgeführte Produktion fand breite Anerkennung und wurde in den folgenden Jahren vielfach aufgeführt, sowohl in ganz Deutschland als auch im Ausland, darunter in Yad Vashem in Jerusalem.Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 142. Das Programm verwob politische Lieder wie Zog nit keyn mol (das Lied der jüdischen Partisanen), traditionelle jiddische Melodien und Werke zeitgenössischer Komponisten, die von Lin Jaldati und Jalda Rebling gemeinsam dargeboten wurden. Die musikalische Gestaltung war so konzipiert, dass sie Episoden aus Anne Franks Tagebuch reflektierte und kommentierte und zugleich die Erfahrungen des Krieges und des Holocaust in einem weiteren Horizont thematisierte. Den Schluss bildeten Kompositionen von Hanns Eisler und Paul Dessau auf Texte von Pablo Neruda.Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 141 f.
Wie Sylke Kirschnick hervorhebt, ist es bemerkenswert, dass das Programm auf ein musikalisches Erbe zurückgriff, das dem assimilierten, großbürgerlichen deutsch-jüdischen Hintergrund der Familie Frank fremd war. Diese Entscheidung verlieh dem Programm eine zusätzliche Deutungsebene, geprägt von den persönlichen Erfahrungen und politischen Überzeugungen Jaldatis und Reblings.Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 142. Im Zentrum stand die Neueinbettung von Anne Franks Geschichte in die Tradition der jiddischen Kultur und der jüdischen Arbeiterbewegung. Mehrere der Lieder, darunter Mordechai Gebirtigs Motele, waren bereits in der Anthologie Jaldatis und Reblings enthalten.Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 141. Das Lied schildert zwar einen Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn, doch mag seine größere Bedeutung anderswo liegen: Gebirtigs Zugehörigkeit zum Bund, dessen prominentes Mitglied er war, verortet das Lied in einer Konzeption jüdischer kultureller Identität, die sich gegenüber Vorstellungen einer zukünftigen homogenen Gesellschaft abgrenzt, zugleich aber im sozialistischen Sinn an revolutionär-emanzipatorische Werte anknüpft.
Gerade dieser partikularistische Aspekt der jiddischen Musik fand, stärker noch als ihre sozialistischen Botschaften, Anklang bei jüngeren ostdeutschen Musikern und Zuhörern, die vom amerikanischen Folk-Revival beeinflusst waren. In Zusammenarbeit mit dem in Kanada geborenen Sänger Perry Friedman, ebenfalls jüdisch, spielte Jaldati eine prominente Rolle im Oktoberklub, dem ostdeutschen Gegenstück zur Hootenanny-Bewegung und einer mit der Freien Deutschen Jugend (FDJ) verbundenen Organisation.Raysh Weiss: Klezmer in the New Germany: History, Identity, and Memory, in: Jay Howard Geller und Leslie Morris (Hg.): Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational, Ann Arbor 2016, 302–320, 305. Zugleich trat sie regelmäßig beim Festival des politischen Liedes auf, das von den 1970er Jahren bis zur Auflösung der DDR jährlich stattfand.David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154), 54. Darüber hinaus wurde Jaldati zu einer wichtigen Wissensquelle und Inspirationsfigur für aufstrebende Interpreten jiddischer und Klezmermusik wie Karsten Troyke und Hardy Reich vom nichtjüdischen Ensemble „Aufwind“.Raysh Weiss: Klezmer in the New Germany: History, Identity, and Memory, in: Jay Howard Geller und Leslie Morris (Hg.): Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational, Ann Arbor 2016, 302–320, 306.
Im Umfeld der Wende kam es zu weiteren kulturellen Initiativen, in denen jiddische und Klezmermusik eine zentrale Rolle spielten. 1987 war Jalda Rebling Mitbegründerin der „Jiddischen Kulturtage“, eines Festivals, das rasch zu einem festen Bestandteil des jüdischen Kulturlebens in Ostdeutschland wurde. In Westdeutschland boten die „Jüdischen Kulturtage“ ebenfalls Aufführungen von Klezmermusik. Wie Raysh Weiss beobachtet, kristallisierte sich allmählich eine Unterscheidung zwischen zwei Strömungen heraus: den älteren, stärker akademisch orientierten Jiddischisten und den neueren „Klezmer-Revivalisten“, die auf Bühnendarbietung und Spektakel setzten, um ein weiteres Publikum zu erreichen.Raysh Weiss: Klezmer in the New Germany: History, Identity, and Memory, in: Jay Howard Geller und Leslie Morris (Hg.): Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational, Ann Arbor 2016, 302–320. Zur „Klezmerisierung“ jüdischer Musik s. Philip V. Bohlman: Historisierung als Ideologie. Die „Klesmerisierung“ der jüdischen Musik, in: Eckhard John und Heidy Zimmermann (Hg.): Jüdische Musik? Fremdbilder – Eigenbilder, Köln, Weimar und Wien 2004 (= Jüdische Moderne 1), 241–255. Jaldatis Beitrag war dem ersten Typus näher als dem zweiten, blieb jedoch in seiner historischen Gestalt einzigartig. In ihren Auftritten verwirklichte sie eine Konzeption jiddischer Kultur als fortdauernden Ausdruck von Jüdischkeit, den sie, vielleicht mehr als jede andere Person, durch ihre vielfältigen Begabungen, ihr Engagement für die Weitergabe jüdische Kulturtraditionen und ihre unmittelbare Erfahrung der Katastrophen des 20. Jahrhunderts zu ihrem eigenen gemacht hat.
Musikalische Erinnerungsarbeit: Osten, Westen und das Virtuelle
Als Teil der Kultur- und Sozialgeschichte ist die jüdische Musik in dem hier verwendeten weiten Sinn seit langem in einen fortlaufenden Prozess der Bestimmung und Neubestimmung ihres Stils, ihrer Bedeutung und ihrer Funktion eingebunden, in Reaktion auf wechselnde Bedürfnisse und Prioritäten von Individuen, Gemeinschaften, Institutionen, Staaten oder sozialen Bewegungen. In Phasen verschärfter ideologischer Spannungen, wie sie weite Teile des 20. Jahrhunderts prägten, war dieser Prozess häufig dadurch gekennzeichnet, dass vorgeprägte Bilder oder Konstruktionen von Judentum und jüdischer Identität aufgegriffen wurden – sei es explizit oder implizit – und dies nicht immer in Form eindeutiger Akte der Affirmation, des Widerspruchs oder der Anpassung. Umgekehrt regten solche übergreifenden ideologischen Strömungen neue Visionen jüdischen Lebens an und führten dazu, dass bestehende musikalische Praktiken und Traditionen angepasst, neu interpretiert oder verworfen wurden.
Obwohl viele jüdische Musiker, die in der DDR wirkten, persönlich vom Kommunismus als sozialer Utopie überzeugt waren, verfolgten sie dennoch unterschiedliche musikalische Wege, deren Bedeutung als Ausdruck von Jüdischkeit von den politischen Autoritäten unterschiedlich bewertet wurde. Diese Einschätzungen wiederum wurden häufig von Verschiebungen im weiteren politischen Klima bestimmt. Für Komponisten, die im Horizont des Sozialistischen Realismus arbeiteten, schien das Erbe der deutschen humanistischen Klassik eine Möglichkeit zu bieten, die Überwindung sozialer Ungerechtigkeit innerhalb einer projizierten harmonischen Ordnung zu entwerfen, in der die jüdische Frage letztlich verdrängt wird. Skeptischere oder kritischere Stimmen hoben dagegen Brüche und Widersprüche des Lebens unter jedem politischen System hervor, wobei die jüdische Erfahrung von Antisemitismus und Holocaust ein besonderes Gewicht gewann. Ausdrucksformen jüdischen Partikularismus blieben dabei verdächtig und umstritten, nicht etwa trotz, sondern gerade wegen ihrer Fähigkeit, Identitäts- und Geschichtserfahrungen zu artikulieren, die sich einer Unterordnung unter die universalistischen ideologischen Narrative des sozialistischen Staates entzogen.
Diese Verwobenheit von jüdischer Musik und jüdischer Erfahrung behält ihre Aktualität, auch im zeitgenössischen, vermeintlich postmodernen Kontext, in dem der Identitätsbegriff selbst zunehmend in einem als selbstverständlich vorausgesetzten Zustand von Fluidität und Pluralität zu zerfallen scheint. Bemerkenswerterweise ist die Produktion und Zirkulation von Bedeutungen, die sich auf musikalische Jüdischkeit beziehen, nicht an das Vorhandensein größerer jüdischer Gemeinschaften gekoppelt, wie das erneute Interesse am jüdischen Kulturerbe in Europa in den letzten Jahrzehnten zeigt.Für eine weiterführende Analyse jüngerer Entwicklungen der jüdischen Musik und Kultur in Europa s. Philip V. Bohlman: Jewish Music and Modernity, New York 2008, 237 ff. In dieser Hinsicht bietet die anhaltende Prominenz der osteuropäisch-jüdischen Musik einen letzten, instruktiven Vergleichspunkt mit der DDR-Zeit.
Befreit von starren politischen Vorgaben und den ideologischen Frontstellungen des Kalten Krieges, zirkuliert diese Musik heute in neuen sozialen und ästhetischen Konstellationen. Im vereinigten Deutschland fiel die wachsende Beliebtheit der Volkstraditionen des jiddischsprachigen Judentums bei nichtjüdischen Musikern und Publika mit ihrer Transformation zu einem Genre der Weltmusik zusammen. Diese Entwicklung bedeutete eine Abkehr vom vokalen jiddischen Repertoire, das lange eng mit der Erinnerung an den Holocaust assoziiert war, hin zu instrumentalen Formen, die die festlichen und feierlichen Dimensionen des Klezmer hervorheben.Aaron Eckstaedt: Yiddish Folk Music as a Marker of Identity in Post-War Germany, in: European Judaism 43/1 (2010), 37–47, 42. Paradoxerweise hat die Klezmer-Renaissance nach der Wende und die breitere Wiederbelebung jüdischer Kultur die begrenzte Beteiligung von Juden selbst deutlich sichtbar werden lassen. Ruth Ellen Grubers Konzept der „virtuellen Jüdischkeit“ (virtual Jewishness) beschreibt dieses Phänomen treffend, in dem jüdische Kultur aus einer Außenperspektive inszeniert wird, oft in Umfeldern, in denen jüdische Präsenz gering ist und in denen solche Aufführungen symbolische jüdische Wirklichkeiten konstruieren, die eine Kontinuität suggerieren, die faktisch fehlt.Ruth Ellen Gruber: Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe, Berkeley, Los Angeles und London 2002, 11 und 219 f.
Der Begriff der virtuellen Jüdischkeit gewinnt zusätzliche Aussagekraft, wenn man ihn vor dem Hintergrund der Situation im ehemaligen Ostdeutschland betrachtet. Gewiss waren die Erfahrungen und Biografien prominenter jüdischer Musiker in der DDR alles andere als virtuell, doch in mancher Hinsicht lassen sich in ihrem Wirken Dynamiken erkennen, die Grubers Konzept vorwegnehmen. Jüdische Musik trat häufig mit einer symbolischen Öffentlichkeit auf, die die demographische Realität der ostdeutschen Juden bei weitem überstieg, und Aspekte ihrer politischen und kulturellen Bedeutung wurden von staatlichen Institutionen, Kulturfunktionären und nichtjüdischen Interpreten von außen definiert. Zugleich unterscheidet sich der DDR-Fall in entscheidenden Punkten von der Situation der Nachwendezeit. Die säkulare ostdeutsche jüdische Kultur agierte nicht in einem Vakuum des Gemeinschaftslebens, sondern in einem politisch vorstrukturierten Umfeld, in dem jüdische Musiker dennoch über beträchtliche Handlungsspielräume verfügten. Ihr Schaffen vollzog sich unter Bedingungen ideologischer Einschränkung, nicht kultureller Abwesenheit, und musikalische Artikulationen von Jüdischkeit konnten zugleich der antifaschistischen Erzählung des Staates dienen und, meist in subtiler Form, als Ausdruck kultureller Spezifik und sogar von Dissens angesichts des Drucks zur ideologischen Vereinheitlichung fungieren. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die DDR als eine historisch spezifische Konfiguration virtueller Jüdischkeit, in der symbolische Konstruktionen jüdischer Kultur mit der gelebten Präsenz jüdischer Künstler koexistierten, statt sie zu überschatten. Die erneute Befassung mit diesen vielschichtigen Bedeutungen legt nahe, dass die Dynamiken, welche die Aushandlung jüdischer Identität während des Kalten Krieges prägten, nicht vollständig der Vergangenheit angehören. Sie wirken vielmehr in das gegenwärtige deutsche und europäische Kulturleben hinein, in dem der Nachhall früherer ideologischer Auseinandersetzungen fortbesteht und in dem Jüdischkeit noch immer häufig von außen ebenso sehr interpretiert, gedeutet oder inszeniert wird wie von innen.
Ausgewählte Literatur
Bohlman, Philip V.: Jewish Music and Modernity, New York 2008.
Borchard, Beatrix und Heidy Zimmermann (Hg.): Musikwelten – Lebenswelten. Jüdische Identitätssuche in der deutschen Musikkultur, Köln, Weimar und Wien 2009 (= Jüdische Moderne 9).
Brown, Julie: Schoenberg and Redemption, Cambridge 2014 (= New Perspectives in Music History and Criticism).
Calico, Joy H.: Arnold Schoenberg’s A Survivor from Warsaw in Postwar Europe, Berkeley, Los Angeles und London 2014 (= California Studies in 20th-Century Music 17).
Dahm, Annkatrin: Der Topos der Juden. Studien zur Geschichte des Antisemitismus im deutschsprachigen Musikschrifttum, Göttingen 2007 (= Jüdische Religion, Geschichte und Kultur 7).
Eckstaedt, Aaron: „Klaus mit der Fiedel, Heike mit dem Bass …“. Jiddische Musik in Deutschland, Berlin 2003.
Feldman, Walter Zev: Klezmer: Music, History, and Memory, New York 2016.
Frühauf, Tina und Lily E. Hirsch (Hg.): Dislocated Memories: Jews, Music, and Postwar German Culture, New York 2014.
Frühauf, Tina: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021.
Frühauf, Tina (Hg.): The Oxford Handbook of Jewish Music Studies, New York 2023.
Haas, Michael: Forbidden Music: The Jewish Composers Banned by the Nazis, New Haven 2013.
HaCohen, Ruth: The Musical Libel against the Jews, New Haven 2011.
Heer, Hannes, Christian Glanz und Oliver Rathkolb (Hg.): Richard Wagner und Wien. Antisemitische Radikalisierung und das Entstehen des Wagnerismus, Wien 2017 (= Musikkontext 11).
Hirshberg, Jehoash: Music in the Jewish Community of Palestine 1880–1948: A Social History, Oxford 1996.
John, Eckhard und Heidy Zimmermann (Hg.): Jüdische Musik? Fremdbilder – Eigenbilder, Köln, Weimar und Wien 2004 (= Jüdische Moderne 1).
Loeffler, James: The Most Musical Nation: Jews and Culture in the Late Russian Empire, New Haven, 2010.
Móricz, Klára: Jewish Identities: Nationalism, Racism, and Utopianism in Twentieth-Century Music, Berkeley, Los Angeles und London 2008 (= California Studies in 20th-Century Music 8).
Nemtsov, Jascha: Der Zionismus in der Musik: Jüdische Musik und nationale Idee, Wiesbaden 2009 (= Jüdische Musik. Studien und Quellen zur jüdischen Musikkultur 6).
Regev, Motti und Edwin Seroussi: Popular Music and National Culture in Israel, Berkeley, Los Angeles und London 2004.
Schmidt, Matthias: Eingebildete Musik. Richard Wagner, das jüdische Wien und die Ästhetik der Moderne, München 2019.
Shelleg, Assaf: Jewish Contiguities and the Soundtrack of Israeli History, New York u. a. 2014.
Shneer, David unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154).
Walden, Joshua S. (Hg.): The Cambridge Companion to Jewish Music, Cambridge 2015.
Waligórska, Magdalena: Klezmer’s Afterlife: An Ethnography of the Jewish Music Revival in Poland and Germany, New York 2013.
Wlodarski, Amy Lynn: Musical Witness and Holocaust Representation, Cambridge 2015.
Anmerkungen
- Innerhalb des Paradigmas der vergleichenden Musikwissenschaft veranschaulichen Abraham Zvi Idelsohns Studien den Versuch, eine einheitliche Geschichte der jüdischen Musik zu konstruieren. Abraham Zvi Idelsohn: Jewish Music in its Historical Development, New York 1972 [1929]. Für eine umfassende Diskussion der Geschichtsschreibung der jüdischen Musik s. Edwin Seroussi: Jüdische Musik, in: Laurenz Lütteken (Hg.): MGG Online, Kassel 2016; online unter: https://www-1mgg-2online-1com-1008e20pu0071.erf.sbb.spk-berlin.de/mgg/stable/537670 (1. 1. 2025).
- Diese Definition folgt der Diskussion jüdischer Kunst bei Matthew Baigell und Milly Heyd in: Matthew Baigell und Milly Heyd (Hg.): Complex Identities: Jewish Consciousness and Modern Art, New Brunswick, NJ, und London 2001, XIV. Siehe auch Klára Móricz: Jewish Identities: Nationalism, Racism, and Utopianism in Twentieth-Century Music, Berkeley, Los Angeles und London 2008 (= California Studies in 20th-Century Music 8), 2.
- Zu jüdischer Musik und antisemitischen Tropen s. Ruth HaCohen: The Musical Libel against the Jews, New Haven 2011, und Annkatrin Dahm: Der Topos der Juden. Studien zur Geschichte des Antisemitismus im deutschsprachigen Musikschrifttum, Göttingen 2007 (= Jüdische Religion, Geschichte und Kultur 7).
- Philip V. Bohlman: Ontologies of Jewish Music, in: Joshua S. Walden (Hg.): The Cambridge Companion to Jewish Music, Cambridge 2015, 11–26.
- Siehe auch Michael Haas: Forbidden Music: The Jewish Composers Banned by the Nazis, New Haven 2013.
- David Nirenberg: Anti-Judaism: The Western Tradition, New York 2013, 455 f.
- Mehr dazu: Pamela M. Potter: Twentieth-Century Reception and Anti-Semitism, in: David Trippett (Hg.): Wagner in Context, Cambridge 2024, 364–372.
- Toby Thacker: Music after Hitler, 1945–1955, Aldershot 2007, 75.
- Albert Hirte: Befreite Klänge, in: Berliner Zeitung, 1. Jg., Nr. 63 vom 27. 7. 1945, 4.
- Zur ideologischen Funktion des Antifaschismusbegriffs in der DDR s. Gerd Dietrich: Kulturgeschichte der DDR, Göttingen 2018, 68 ff.
- Vgl. Sarah Collins: The National and the Universal, in: Paul Watt, Sarah Collins und Michael Allis (Hg.): The Oxford Handbook of Music and Intellectual Culture in the Nineteenth Century, New York 2020, 369–386, 370.
- „-walt“ in: Alldeutsches Tagblatt, 7. Jg. (1909), vom 31. 1. 1909; zitiert nach Martin Eybl (Hg.): Die Befreiung des Augenblicks: Schönbergs Skandalkonzerte 1907 und 1908. Eine Dokumentation, Wien 2004 (= Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 4), 237.
- Vgl. Martin Eybls Diskussion in: ders.: (Hg.): Die Befreiung des Augenblicks: Schönbergs Skandalkonzerte 1907 und 1908: Eine Dokumentation, Wien 2004 (= Wiener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte 4), 37 ff.
- Arnold Schoenberg: Two Speeches on the Jewish Situation, in: ders.: Style and Idea: Selected Writings, hg. von Leonard Stein, übers. von Leo Black, mit einem neuen Vorwort von Joseph Auner, Berkeley u. a. 1984, 501–505, 502 f.
- Zu einer Untersuchung von Wagners Einfluss auf Schönbergs Hinwendung zur Atonalität s. Julie Brown: Schoenberg and Redemption, Cambridge 2014 (= New Perspectives in Music History and Criticism). Zu Wagner und Antisemitismus s. die Beiträge in: Hannes Heer, Christian Glanz und Oliver Rathkolb (Hg.): Richard Wagner und Wien. Antisemitische Radikalisierung und das Entstehen des Wagnerismus, Wien 2017 (= Musikkontext 11).
- Mehr dazu: Karen Painter: Polyphony and Racial Identity: Schoenberg, Heinrich Berl, and Richard Eichenauer, in: Music & Politics 5/2 (2011); online unter: https://quod.lib.umich.edu/m/mp/9460447.0005.203/--polyphony-and-racial-identity-schoenberg-heinrich-berl?rgn=main;view=fulltext (1. 1. 2025).
- Heinrich Berl: Das Judentum in der abendländischen Musik, in: Der Jude. Eine Monatsschrift 6 (1921/22), 495–505, 495.
- Max Brod: Gustav Mahlers jüdische Melodien, in: Musikblätter des Anbruch 2 (1920), 378 f., sowie ders.: Jüdische Volksmelodien, in: Der Jude. Eine Monatsschrift 1 (1916/17), 344 f.
- Max Brod und Yehuda Walter Cohen: Die Musik Israels, Kassel u. a. 1976, 18. Der erste Teil dieses Buches wurde 1951 von Brod abgeschlossen.
- Theodor Lessing: Der jüdische Selbsthass, Berlin 1984 [1930].
- Vgl. Mark Berry: Arnold Schoenberg’s “Biblical Way”: From “Die Jakobsleiter” to “Moses und Aron”, in: Music & Letters 89 (2008), 84–108.
- Menachem Avidom war über seine Mutter, die eine Cousine Gustav Mahlers war, mit diesem familiär verwandt.
- Zitiert nach Gdal Saleski: Famous Musicians of Jewish Origin, New York 1949, 20.
- Vgl. Ronit Seter: Israelism: Nationalism, Orientalism, and the Israeli Five, in: The Musical Quarterly 97 (2014), 238–308.
- Vgl. Assaf Shelleg: Jewish Contiguities and the Soundtrack of Israeli History, New York u. a. 2014, 5 ff., und Ronit Seter: Israelism: Nationalism, Orientalism, and the Israeli Five, in: The Musical Quarterly 97 (2014), 238–308.
- Max Brod und Yehuda Walter Cohen: Die Musik Israels, Kassel u. a. 1976, 27.
- Zu Mussorgski und Antisemitismus s. Richard Taruskin: Musorgsky: Eight Essays and an Epilogue, Princeton 1993, 379 ff.
- Lessing: Der jüdische Selbsthass. Siehe insbes. die Kapitel über Otto Weininger und Arthur Trebitsch.
- Max Brod und Yehuda Walter Cohen: Die Musik Israels, Kassel u. a. 1976, 13.
- Theo Stengel und Herbert Gerigk: Lexikon der Juden in der Musik, Berlin 1940, 245 und 239.
- Karin Hartewig: Zurückgekehrt: Die Geschichte der jüdischen Kommunisten in der DDR, Köln, Weimar und Wien 2000, 4.
- Vgl. Karin Hartewig: Zurückgekehrt. Die Geschichte der jüdischen Kommunisten in der DDR, Köln, Weimar und Wien 2000, 27 ff.
- Zu Eisler als jüdischem Komponisten s. Andrea F. Bohlman und Philip V. Bohlman: Hanns Eisler. „In der Musik ist es anders“, Berlin 2012 (= Jüdische Miniaturen 126).
- Vgl. Karin Hartewig: Zurückgekehrt. Die Geschichte der jüdischen Kommunisten in der DDR, Köln, Weimar und Wien 2000, 3 ff.
- 1971 hob der Philosoph und Musikwissenschaftler Vladimir Jankélévitch die Position Israels im Antisemitismus der Zeit nach dem Holocaust hervor und bemerkte: „[Den Juden] wurde nicht vorgeworfen, dies oder jenes zu bekennen, ihnen wurde vorgeworfen, zu sein. Bis zu einem gewissen Grad erstreckt sich diese Verweigerung sogar heute noch auf die Existenz des Staates Israel.“ Vladimir Jankélévitch: Should We Pardon Them?, in: Critical Inquiry 22 (1996), 552–572. Ann Hobart übersetzte diesen Artikel aus seiner ursprünglichen Veröffentlichung von 1965 ins Englische.
- Mehr dazu bei Cathy Gelbin und Sander Gilman: Cosmopolitanisms and the Jews, Ann Arbor 2017 (= Social History, Popular Culture, and Politics in Germany).
- Bruno Chaouat: Is Theory Good for the Jews? French Thought and the Challenge of the New Antisemitism, Liverpool 2016, XIX f. Für Deutschers Originalaufsatz s. Isaac Deutscher: The Non-Jewish Jew and Other Essays, hg. von Tamara Deutscher, London 2017, 30–42.
- Zur Beziehung der DDR zu Israel s. Jeffrey Herf: Undeclared Wars with Israel: East Germany and the West German Far Left, 1967–1989, York u. a. 2016.
- Jeffrey Herf: Undeclared Wars with Israel: East Germany and the West German Far Left, 1967–1989, New York u. a. 2016, 51.
- In der DDR und anderen Staaten des Ostblocks unterlagen auch andere kulturelle und musikalische Praktiken vergleichbaren Maßnahmen und Einschränkungen. Zur Volksmusik im Kommunismus s. Ulrich Morgenstern: Communism and Folklore Revisited: Russian Traditional Music and the Janus-faced Nature of Soviet Cultural Politics, in: Interdisciplinary Studies in Musicology 22 (2022), 63–80.
- Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670.
- Ingward Ullrich: Hildburghäuser Musiker. Ein Beitrag zur Musikgeschichte der Stadt Hildburghausen, Hildburghausen 2003, 194.
- Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670, 668.
- Zum Zionismus aus der Sicht des ostdeutschen politischen Establishments s. Angelika Timm: Views on Zionism and Israel in East Germany, in: Shofar 18/3 (2000), 93–109.
- Ich danke dem Deutschen Rundfunkarchiv, Zentrale Information, für zusätzliche Informationen zu diesen Aufnahmen, die im Rahmen einer E-Mail-Korrespondenz am 8. Mai 2012 zur Verfügung gestellt wurden.
- Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670, 669 f.
- Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670, 670.
- Zum Sozialistischen Realismus im Kontext der Musik der Sowjetrepubliken s. Marina Frolova-Walker: “National in Form, Socialist in Content”: Musical Nation-Building in the Soviet Republics, in: Journal of the American Musicological Society 51 (1998), 331–371.
- Vgl. David G. Tompkins: Composing the Party Line: Music and Politics in Early Cold War Poland and East Germany, West Lafayette, Indiana 2013 (= Central European Studies), 19.
- Vgl. Angelika Timm: Views on Zionism and Israel in East Germany, in: Shofar 18/3 (2000), 93–109.
- Rosemarie Frank: Neue israelische Musik in unserem Rundfunk, in: MuG 10 (1960), 668–670, 669.
- Eine E-Mail von Manns Tochter, die zu dieser Frage Auskunft gibt, ist im folgenden Blogeintrag wiedergegeben: https://onegshabbat.blogspot.com/2012/11/blog-post_29.html (1. 1. 2025).
- Zum nationalen Mythos des Antifaschismus in der DDR s. Alan L. Nothnagle: Building the East German Myth: Historical Mythology and Youth Propaganda in the German Democratic Republic, 1945–1989, Ann Arbor 2002, 93 ff.
- Vgl. Golan Gur: Classicism as Anti-Fascist Heritage: Realism and Myth in Ernst Hermann Meyer’s Mansfelder Oratorium (1950), in: Kyle Frackman und Larson Powell (Hg.): Classical Music in the German Democratic Republic: Production and Reception, Rochester 2015 (= Studies in German Literature, Linguistics, and Culture), 34–57.
- M. Rainer Lepsius: Die Teilung Deutschlands und die deutsche Nation, in: ders.: Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1993 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 100), 196–229, 227.
- M. Rainer Lepsius: Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des „Großdeutschen Reiches“, in: ders.: Demokratie in Deutschland. Soziologisch-historische Konstellationsanalysen. Ausgewählte Aufsätze, Göttingen 1993 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 100), 229–245, 232.
- Zum Film „Avodah“ s. Ofer Ashkenazi: The Symphony of a Great Heimat: Zionism as a Cure for Weimar Crisis in Lerski’s Avodah, in: Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational, hg. von Jay Howard Geller und Leslie Morris, Ann Arbor 2016, 91–122.
- Joy H. Calico: “Jüdische Chronik”: The Third Space of Commemoration between East and West Germany, in: The Musical Quarterly 88 (2005), 95–122.
- Silvia Schlenstedt: Die Kollektivkomposition Jüdische Chronik (1960–1961), in: Helmut Peitsch (Hg.) in Verbindung mit Konstantin Baehrens u. a.: Nachkriegsliteratur als öffentliche Erinnerung. Deutsche Vergangenheit im europäischen Kontext, Berlin und Boston [2019], 394–406, 400.
- Joy H. Calico: “Jüdische Chronik”: The Third Space of Commemoration between East and West Germany, in: The Musical Quarterly 88 (2005), 95–122, 101.
- Joy H. Calico: “Jüdische Chronik”: The Third Space of Commemoration between East and West Germany, in: The Musical Quarterly 88 (2005), 95–122, 107.
- Ernst Hermann Meyer: Kontraste, Konflikte: Erinnerungen, Gespräche, Kommentare, hg. von Dietrich Brennecke und Mathias Hansen, Berlin 1979, 241. Die ursprüngliche Passage findet sich in: Ernst H. Meyer: Musik im Zeitgeschehen, hg. von der Deutschen Akademie der Künste, Berlin 1952, 151.
- Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 228.
- Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 230.
- Zitiert in: Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 230 f.
- Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 230.
- Zitiert in: Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 229.
- Siehe auch Julia Glänzel: Arnold Schönberg in der DDR: Ein Beitrag zur verbalen Schönberg-Rezeption, Berlin 2013, 234.
- Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 465.
- Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 465 f. Zur Episode des Goldenen Kalbs s. Yoel Greenberg: “These Are Your Gods, Oh Israel”: Chosenness in Schoenberg’s “Moses und Aron” as a Response to Houston Stewart Chamberlain’s “Foundations”, in: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 48 (2017), 71–99.
- Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 467.
- Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 465.
- Eberhard Rebling: Arnold Schönbergs Lebensbekenntnis. Gedanken zu seiner Oper „Moses und Aron“, in: MuG 7 (1957), 462–467, 467.
- Zu Werner Sander s. Tina Frühauf: Werner Sander „den Frieden endgültig zu festigen“. Ein großer Vertreter der jüdischen Musik in der DDR, Berlin 2017 (= Jüdische Miniaturen 213), sowie dies.: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021, 194 ff.
- Tina Frühauf: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021, 194.
- Tina Frühauf: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021, 210.
- Tina Frühauf: Transcending Dystopia: Music, Mobility, and the Jewish Community in Germany, 1945–1989, New York 2021, 200.
- Ruth Ellen Gruber: Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe, Berkeley 2002, 10 f.
- Die biografischen Angaben hier stammen größtenteils von David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154).
- David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154), 9 f.
- David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154), 11 f.
- David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154), 16–22.
- Lin Jaldati und Eberhard Rebling: Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, übers. von Heinz Kahlau, Berlin 1966.
- Lin Jaldati und Eberhard Rebling: Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, übers. von Heinz Kahlau, Berlin 1966, 6.
- Lin Jaldati und Eberhard Rebling: Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, übers. von Heinz Kahlau, Berlin 1966, 12.
- Lin Jaldati und Eberhard Rebling: Es brennt, Brüder, es brennt. Jiddische Lieder, übers. von Heinz Kahlau, Berlin 1966, 12.
- J. V. Stalin: Marxism and the National Question (1913); online unter: https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03a.htm (1. 1. 2025).
- V. I. Lenin: Critical Remarks on the National Question (1913); online unter: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1913/crnq/index.htm (1. 1. 2025).
- Dennoch gibt es auch jiddische Musik, die von zionistischen Themen inspiriert ist. Vgl. Jascha Nemtsov: Der Zionismus in der Musik: Jüdische Musik und nationale Idee, Wiesbaden 2009 (= Jüdische Musik. Studien und Quellen zur jüdischen Musikkultur 6), 132 ff.
- Interview mit Lin Jaldati und Eberhard Rebling; online unter: https://archive.org/details/lin-und-eberhard-die-geschichte-einer-grossen-liebe-ed-stuhler-2013. Ein Transkript des Interviews ist verfügbar unter: https://assets.deutschlandfunk.de/FILE_803fa3499fc2c9bbba9cbee81c1c5b24/original.pdf (1. 1. 2025).
- Dies war nicht der erste kulturelle Anlass, bei dem Lin Jaldati öffentlich mit Anne Frank in Verbindung gebracht wurde. Im April 1957 trug sie bei einer Gedenkveranstaltung zum Aufstand im Warschauer Ghetto jiddische Lieder vor, während Katharina Herberg Auszüge aus Anne Franks Tagebuch las. Dazu: Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 138.
- Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 142.
- Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 141 f.
- Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 142.
- Sylke Kirschnick: Anne Frank und die DDR. Politische Deutungen und persönliche Lesarten des berühmten Tagebuchs, Berlin 2009, 141.
- Raysh Weiss: Klezmer in the New Germany: History, Identity, and Memory, in: Jay Howard Geller und Leslie Morris (Hg.): Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational, Ann Arbor 2016, 302–320, 305.
- David Shneer unter Mitarbeit von Jalda Rebling: Lin Jaldati. Trümmerfrau der Seele, übers. von Joseph Rebling, hg. vom Centrum Judaicum, Berlin 2015 (= Jüdische Miniaturen 154), 54.
- Raysh Weiss: Klezmer in the New Germany: History, Identity, and Memory, in: Jay Howard Geller und Leslie Morris (Hg.): Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational, Ann Arbor 2016, 302–320, 306.
- Raysh Weiss: Klezmer in the New Germany: History, Identity, and Memory, in: Jay Howard Geller und Leslie Morris (Hg.): Three-Way Street: Jews, Germans, and the Transnational, Ann Arbor 2016, 302–320. Zur „Klezmerisierung“ jüdischer Musik s. Philip V. Bohlman: Historisierung als Ideologie. Die „Klesmerisierung“ der jüdischen Musik, in: Eckhard John und Heidy Zimmermann (Hg.): Jüdische Musik? Fremdbilder – Eigenbilder, Köln, Weimar und Wien 2004 (= Jüdische Moderne 1), 241–255.
- Für eine weiterführende Analyse jüngerer Entwicklungen der jüdischen Musik und Kultur in Europa s. Philip V. Bohlman: Jewish Music and Modernity, New York 2008, 237 ff.
- Aaron Eckstaedt: Yiddish Folk Music as a Marker of Identity in Post-War Germany, in: European Judaism 43/1 (2010), 37–47, 42.
- Ruth Ellen Gruber: Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe, Berkeley, Los Angeles und London 2002, 11 und 219 f.