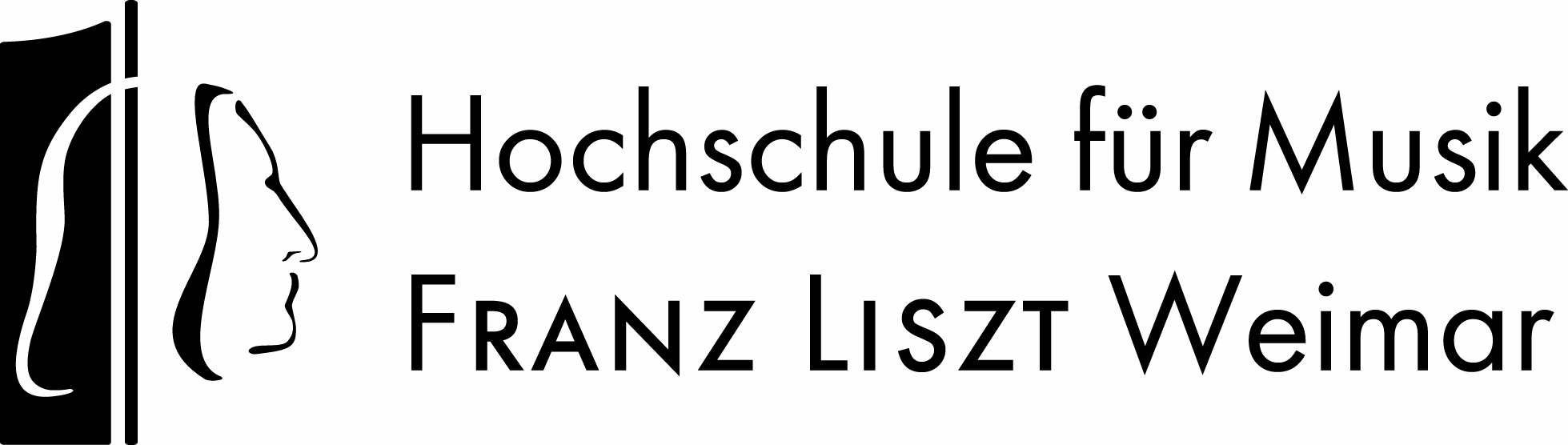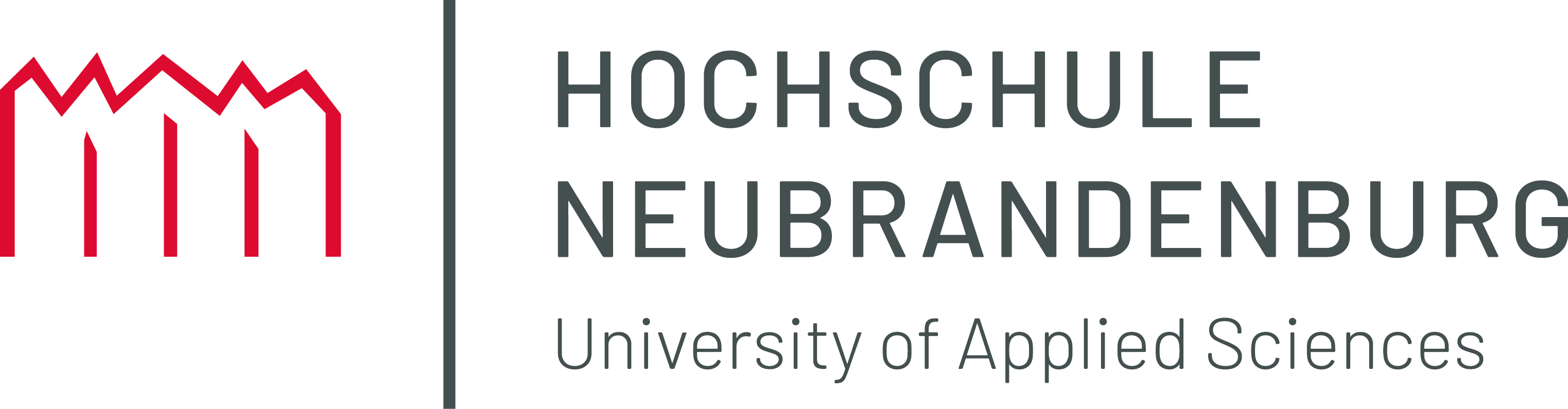Die Anderen Bands
Zusammenfassung
I. Relationalität der Macht
Folgt man dem Berliner Mauerweg zwischen Mitte und Kreuzberg über den Engeldamm in Richtung Ostbahnhof, so findet sich rechter Hand das Bethanien, ein früher mal vom Abriss bedrohter Gebäudekomplex auf Kreuzberger Seite, bekannt seit den 1970er Jahren u. a. als besetztes Haus, Kunstquartier oder links-autonomes Zentrum – rockmusikalisch in Szene gesetzt von der Band Ton Steine Scherben.Insbesondere der „Rauch-Haus-Song“ vom zweiten Scherben-Album „Keine Macht für Niemand“ (1972) thematisiert die Hausbesetzung im Dezember 1971 bzw. die Polizeirazzia im April 1972 unter Bezugnahme auf den zuvor erschossenen Georg von Rauch. Die aus West-Berlin stammende Band Ton Steine Scherben stellt außerdem einen bedeutenden musikalischen und textlichen Einfluss auch auf die Anderen Bands der DDR dar, welcher sich beispielsweise im Programm der Ost-Berliner Band Freygang in Form von Cover-Songs wie beispielsweise „Ich will nicht werden, was mein Alter ist“ (Ton Steine Scherben, 1971) niederschlägt. Vgl. André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 283–285. Überquert man nun im weiteren Verlauf die Spree, so zeigen sich am anderen Flussufer noch immer die Spuren der einstigen Techno-Bewegung, die hier seit den 1990er Jahren im ehemaligen Grenzgebiet das Niemandsland rekultiviert und in Form von Clubs und Wohnprojekten (Maria am Ostbahnhof, Bar 25 etc.) wiederbelebt hat. In beiden Fällen agieren die Akteure (wenn auch auf unterschiedliche Weise, verschiedenartig motiviert bzw. verschiedene Ziele verfolgend) jeweils zeitbezogen in direkter Auseinandersetzung mit den gesellschaftspolitischen Umständen (nach 1968 bzw. nach 1989) und nutzen dabei die sich bietenden, geistigen und materiellen Freiräume (hier im langen Schatten der Mauer), um nach eigenen Vorstellungen und Entwürfen alternative Lebens- und Kunstformen zu erproben (und zu feiern).
Zwischen diesen markanten Beispielen der jüngeren deutschen Pop-Kulturgeschichte erstreckt sich der Gegenstand dieser Ausführungen – die Anderen Bands der DDR – vor allem auf die 1980er Jahre und lässt sich innerhalb dieser zeitlichen Rahmung auch auf inhaltlicher Ebene stimmig einfügen, in die angedeutete Erzählung einer, über weite Strecken vor allem von der jeweiligen Musik getragenen Alternativkultur, welche in beständiger Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten nach mehr Unabhängigkeit und Selbstbestimmung strebt. Im diktatorisch geprägten System erscheint dieser Prozess dann jedoch beinahe zwangsläufig und intensiviert als ein verschärfter Konflikt, der sehr weitreichend die gesamte staatsbürgerliche Existenz betreffen kann und auf unterschiedlichen, öffentlichen, beruflichen oder privaten Ebenen oft in direkter Konfrontation mit den sogenannten Machthabern erfolgt. Die hier auszumachende permanente Wechselwirkung zwischen Musikern, künstlerischen Intensionen, Publikum, staatlichen Institutionen, Verordnungen und offiziellen kulturpolitischen Entscheidungsträgern nimmt dabei einen hohen gesellschaftspolitischen Stellenwert ein und lässt schließlich ein überaus komplexes und fragiles Beziehungsgeflecht erkennen, welches die eigentliche, zeit- und raumspezifische „Relationalität der Macht“Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I, Frankfurt a. M. 2019, 95. im gesamtgesellschaftlichen Kontext als einen eher instabilen und prozesshaften Balanceakt zeigt, der von Michel Foucault wie folgt beschrieben wird:
„Unter Macht verstehe ich hier nicht die Regierungsmacht, als Gesamtheit der Institutionen und Apparate, die die bürgerliche Ordnung in einem gegebenen Staat garantieren. […] Unter Macht, scheint mir, ist zunächst zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse verwandelt, verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kräfteverhältnisse aneinander finden, indem sie sich zu Systemen verketten – oder die Verschiebungen und Widersprüche, die sie gegeneinander isolieren; und schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern.“Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I, Frankfurt a. M. 2019, 93.
Gemäß der hier dargestellten polydirektionalen Machtentfaltung erscheint auch der künstlerische Spielraum der Anderen Bands als ein relationaler Handlungsraum,Zur soziologisch geprägten Begrifflichkeit des relationalen Handlungsraums bzw. zur Entstehung von Raum in der Wechselwirkung zwischen Handeln und Strukturen vgl. Martina Löw: Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001, 152 ff. der offen angeschlossen in unmittelbarem Zusammenhang steht, mit den reglementierenden Instanzen des Staates und dabei ein dynamisches Geschehen in Gang hält, welches den äußeren Bezugsrahmen aus institutionell gebundenen Verordnungen und bindenden Restriktionen beständig verschiebt, aufweicht, verstärkt, beleuchtet, verhärtet, erweitert oder gar aufhebt. Die Annahme einer rein vertikal ausgerichteten Kräfterelation, innerhalb welcher eine entsprechend motivierte Staatsmacht diktatorisch quasi von oben nach unten wirkt, um so die Untergebenen als Ohnmächtige im Sinne der Mächtigen zu lenken, würde in diesem Kontext ganz sicher zu kurz greifen.Auf die kontextuelle Bedeutung der hier relevanten Bands und die tatsächliche Komplexität der gesellschaftlichen Gesamtsituation bzw. auf die unzureichende Annahme einer lediglich bipolaren Zweidimensionalität der Kräfteverhältnisse verweist bereits einer der frühesten Texte zu dieser Thematik: „Für beide Seiten, die sicherlich nicht mit dem simplen Konstrukt ‚Musiker und Publikum hier – Institutionen da‘ gleichzusetzen sind, gibt es ernstzunehmende Argumente. Doch so vielschichtig sich die Problematik auch darstellt, unsere Gesellschaft kommt um eine Bewertung nicht herum. Wir sind nun aufgefordert, unsere Meinung zum Thema ‚Alternativrock‘ zu Papier zu bringen […].“ Uwe Baumgartner, Susanne Binas, Peter Zocher: „Alternativrock“ in der DDR?, Leipzig 1989 (Forschungszentrum Populäre Musik, HU-Berlin, FPM-Publikation 27, 1989), 1, online unter https://www.musikundmedien.hu-berlin.de/de/musikwissenschaft/pop/forschungszentrum-populaere-musik/baumgartner-uwe-binas-susanne-zocher-peter-1989-alternativrock-in-der-ddr.pdf (30. 11. 2024). Die Macht über andere zu bestimmen (power over) bzw. die Macht selbstbestimmt zu handeln (power to)Zur Unterscheidung von power to/power over innerhalb des Machtbegriffs vgl. Boris Voigt: Memoria, Macht, Musik, Eine politische Ökonomie der Musik in vormodernen Gesellschaften, Kassel u. a. 2008, 19 f. lässt sich hier vielmehr zirkulär immer wieder ganz verschiedenen Akteuren zuschreiben (ebenso wie das gegenteilige Unvermögen, die Ohnmacht) – ein beständiger Feedback-Loop zwischen politischer und (sub-)kultureller Praxis, welcher als Motor (neben vielen negativen Aspekten) durchaus bedeutende kreative Kräfte freisetzt und künstlerische Phänomene evoziert, die in dieser Form nur unter den spezifischen Bedingungen sozialistischer Kulturpolitik möglich sind.Zum Verhältnis von Macht und Freiheit bei Michel Foucault vgl. Byung-Chul Han: Was ist Macht?, Stuttgart 2005 (= Universal-Bibliothek 18356), 124 ff.
Der musikalische Output von Bands wie Freygang, Feeling B, die anderen, Schleim-Keim, Die Zucht/Die Art, Namenlos, Rosa Extra/Hard-Pop, DEKAdance, Herbst in Peking, Die Firma, Sandow, Ornament & Verbrechen, Die Vision, Der Expander des Fortschritts, Kaltfront, L’Attentat, Die Skeptiker, AG Geige, WK 13, Der Demokratische Konsum, Das Freie Orchester, Cadavre Exquis, Wartburgs für Walter, Ichfunktion, Tausend Tonnen Obst oder Tina Has Never Had A Teddy Bear reicht dabei sehr weitgreifend von Bluesrock über Punk und New Wave bis hin zu experimentellen Elektroklängen, so dass der grundlegende und wesentliche Zusammenhang dieser kulturellen (Gegen-)Bewegung weniger in der klanglichen Organisation zu finden ist, sondern vielmehr bestimmt wird, durch eine selbstbewusste Grundhaltung, die wiederum eine weitestgehend eigenverantwortliche Selbstorganisation der künstlerischen Produktionszusammenhänge und darüber hinaus eine verstärkte Selbstermächtigung hinsichtlich der individuellen Lebensgestaltung begründet. Das von verschiedenen Seiten bzw. aus unterschiedlichen Perspektiven mit jeweils ganz eigenen Untertönen herausgestellte (zumeist großgeschriebene) Andere dieser Musikpraxis erscheint dabei sowohl in grundsätzlicher Abhängigkeit eingebunden in den begrenzten und durchorganisierten Kulturraum der DDR als auch entgrenzt, spontan, oppositionell und unangepasst – in jedem Fall ein schräger Kontrapunkt zwischen den staatlich vorsortierten und für die offiziell umsorgte Jugend reservierten Stuhlreihen.
Anhand von repräsentativen Beispielen sollen nun gerade diese Perspektiven gemäß der angedeuteten kulturpolitischen Dynamik im relationalen Handlungsspielraum untersucht werden, allerdings ohne dabei eine auf Vollständigkeit bedachte, entwicklungsgeschichtliche Gesamtdarstellung der Szene anzustreben. Vielmehr soll insbesondere die kreisläufige Wechselwirkung zwischen Band, Publikum und Staat, die gegenseitige Einflussnahme und die damit verbundene Begriffsentwicklung aufgezeigt werden, so dass schließlich der Ausdruck Die Anderen Bands nicht mehr lediglich als lose Sammelbezeichnung erscheint, sondern als relevanter Begriff im Kontext von musikwissenschaftlicher und kulturpolitischer Reflexion zum Tragen kommen kann.
II. Lieder machen Leute
Das „andere“
Zu den „großen Linien und institutionellen Kristallisierungen“ (Foucault) gehört auch der Bau der Berliner Mauer im August 1961, welcher in erster Linie die Massenabwanderung vor allem von qualifizierten Arbeitskräften in die Bundesrepublik und damit den wirtschaftlichen Kollaps der DDR verhindern soll. Was diese einschneidende Maßnahme allerdings nicht verhindern kann, ist im Gegenzug ein beständiger Informationszufluss, bestehend auch aus den musikbezogenen Rundfunkbeiträgen der Westmedien, deren maßgeblicher Einfluss insbesondere auf die empfängnisbereite Jugend der Republik (und schließlich auf die Entwicklung ganzer Jugendkulturen) die Strahlkraft des ostdeutschen Programmangebots weit übertrifft. Hier erweist sich der Eiserne Vorhang von Beginn an nicht nur als durchlässig, sondern immer auch als Resonanz- und Wirkungsverstärker, welcher gerade dem Sound der Zeit – vor allem den Songs der britischen und angloamerikanischen Beat- und Rockmusik – zusätzliche Attraktivität und gesteigerte Ausdruckskraft verleiht. Die auf materieller Ebene mit dem Mauerbau zementierte Barriere begründet dabei eine scheinbar unüberwindbare Distanz (zur westlichen Kultursphäre), welche jedoch gleichzeitig als stark motivierender Freiraum die Phantasien, Hoffnungen und Wünsche vieler Menschen nährt und gerade in Verbindung mit den emotionsgeladenen Freiheitsversprechen der Musik auch transformiert. Was in dieser sehr speziellen historischen Situation zunächst lediglich aus der Ferne über die wenigen offenen Kanäle tatsächlich an Rockmusik durchdringt, fungiert nun ebenfalls als ein beständig resonierendes Medium, mit dessen Hilfe wiederum das (wie auch immer geartete) Abwesende, das Unverfügbare oder Vorenthaltene als das „andere“ innerhalb der real-sozialistischen Existenz zum Ausdruck kommen kann:
„Der Mythos des Rock von Freiheit und Gemeinschaft hatte im DDR-Sozialismus eine Kraft wie kaum irgendwo sonst, stand er doch vage und diffus für das schlechthin ‚andere‘. Eine Gesellschaft, die sich immer nur als Alternative definiert, aber diese in unerreichbare Ferne rückt, produziert ein Vakuum, das um so größer wird, je stärker sie sich abzugrenzen sucht. Das ‚andere‘ ist auf diese Weise nicht nur unablässig gegenwärtig, es erhält vor allem, weil es immer nur als Negativkonstrukt erscheint, eine Anziehungskraft, die nicht in ihm selbst gründet, sondern vielmehr in seiner Funktion als einer Leerstelle, die mit Projektionen aller Art aufgefüllt werden kann und daraus ihre Attraktivität bezieht. So hat der ideologische Diskurs ungewollt, aber darum um so wirksamer, stets genau das erzeugt, was er verhindern sollte. Rockmusik war in der DDR für die hier aufwachsenden jungen Generationen eine kulturelle Form, die dieses ‚andere‘ versinnlichte, ein Medium für Träume, Sehnsüchte und lustvolle Selbsterfahrung, angefüllt mit Projektionen aus den eigenen widersprüchlichen Alltagserfahrungen, nicht eigentlich subversiv, eher selbstbewußt.“Peter Wicke: Zwischen Förderung und Reglementierung – Rockmusik im System der DDR-Kulturbürokratie, in: ders., Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 11–27, 11 f.
Im Rahmen dieser, von Peter Wicke sehr genau erfassten, DDR-spezifischen Rezeptionssituation erscheint Rockmusik als ein Trägermedium, welches das „andere“ re-formuliert („versinnlicht“) und somit letztlich auch selbst verkörpert (wenn auch „vage und diffus“). Die hiervon ausgehenden Impulse erweitern dabei nicht nur medial den staatsbürgerlichen Horizont, sondern stimulieren und inspirieren unter Umständen eine vergleichsweise unabhängige Persönlichkeitsentwicklung jenseits vom sozialistischen Kollektiv („nicht eigentlich subversiv, eher selbstbewußt“), welche gerade auf individueller Ebene die oben angeführte, eher passiv ausgerichtete Empfängnisbereitschaft mit einem aktiven Sendungsbewusstsein rückkoppelt. Hier lässt sich die von Mick Jagger in dem Song Street Fighting Man (Rolling Stones, 1968) gesungene Frage „Well now, what can a poor boy do?“ erneut anbringen – die Antwort lautet ebenfalls: Musik machen! Im Anschluss an die weltweiten Erfolge der britischen und angloamerikanischen Beat- und Rockbands greifen auch in Ostdeutschland mit Beginn der 1960er Jahre hunderte von jungen Menschen zu Gitarre, Bass und Schlagzeug, um damit ihrem Lebensgefühl einen zeitgemäßen, der eigenen Erfahrungswelt angemessenen Ausdruck zu verleihen, auch wenn dieser dann den staatseigenen Vorstellungen hinsichtlich einer freien deutschen Jugendkultur im Sozialismus zum Teil deutlich widerspricht.Zu diesen frühen Aufbrüchen vgl. Michael Rauhut: Beat in der Grauzone. DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, Berlin 1993 (= BasisDruck Dokument 16).
Damit verweist diese frühe Situation (mit Bands wie beispielsweise The Butlers aus Leipzig, 1962–1965) in direkter Linie auf das spätere Werken und Wirken der Anderen Bands, deren künstlerische Energie ebenfalls innerhalb des relationalen Machtgefüges zunimmt und sich dann zum Teil auch jenseits der offiziell geforderten (und geförderten) Kulturstandards sehr erfolg- und einflussreich entfaltet. Diese, zunächst als staatsgefährdend eingestufte Entwicklung, wird von konservativen Funktionären schon frühzeitig mit Angst und Sorge vorhergesehen und soll dementsprechend bereits im Vorfeld auf breiter Ebene entweder abgeschwächt, eingedämmt, gänzlich verhindert oder aber im Sinne der sozialistischen Sache umfunktioniert werden. Mit Blick auf die Hintergründe der hierbei zum Tragen kommenden Kulturverwaltung führt Peter Wicke zwei ganz wesentliche Aspekte des tatsächlich äußerst umfangreichen und vielschichtigen Staatswesens an – das „ausgeprägte Sicherheits- und Machtdenken“ und die „weltfremde Umerziehungsprogrammatik“Peter Wicke: Zwischen Förderung und Reglementierung – Rockmusik im System der DDR-Kulturbürokratie, in: ders., Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 11–27, 17. – welche sich weiterführend wiederum mit verschiedenen „institutionellen Kristallisierungen“ (Foucault) in Verbindung bringen lassen, die gerade auch hinsichtlich der Anderen Bands von grundlegender Bedeutung sind und darum an dieser Stelle eine kurze Vorstellung erfordern.
Einstufung
Im Rahmen des allgegenwärtigen Erlaubnis(un)wesens der DDR wird bereits ab 1953 sukzessive auf der Grundlage von einzelnen, sich teilweise ergänzenden Anordnungen ein offiziell verpflichtendes Einstufungssystem auf den Weg gebracht, um damit die vielschichtigen Beziehungen zwischen staatlichen Institutionen, Musikschaffenden und der jeweiligen Szene (Konzertbetrieb, Fans, Klubs etc.) in möglichst umfassender Weise zu definieren und insbesondere die Ausübung von Tanz- und Unterhaltungsmusik im öffentlichen Raum zu regulieren, zu kontrollieren und ggf. auch zu zensieren.Die in diesem Zusammenhang häufig angeführte staatliche Vorgabe (umgesetzt von der Anstalt zur Wahrung der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte auf dem Gebiet der Musik, AWA) – bekannt als 60/40-Regel, die besagt, dass im öffentlichen Kontext mindestens 60 % der gespielten Musik aus der DDR bzw. dem Ostblock kommen soll, erscheint hinsichtlich der Anderen Bands weniger von Bedeutung, da deren Programme größtenteils aus Eigenkompositionen bestehen und die Forderung somit gar zu 100 % erfüllen. Hierbei fungiert eine im Vorfeld arrangierte Aufführung (z. B. der Auftritt einer Rockband) als Einstufungsvorspiel, welches einer staatlichen Einstufungskommission (Rat des Kreises/Abteilung Kultur) dazu dient, die auditiven, visuellen und insbesondere die textlichen Aspekte und Eigenschaften der Darbietung entsprechend auszuwerten und im Abgleich mit den staatseigenen Vorstellungen und Kriterien zu beurteilen. Das jeweilige (nicht immer rational nachvollziehbare) Urteil der (fachlich oft nicht optimal besetzten) Kommission entspricht dann tatsächlich einer Einstufung, da die mögliche Erteilung der Spielerlaubnis (gerne auch als Musikerpappe bezeichnet) und die damit verbundene Festlegung vor allem der zukünftigen Verdienstmöglichkeiten, auf der Grundlage eines vorgegebenen Stufensystems – bestehend aus Grund-, Mittel-, Ober- und Sonderstufe – erfolgt. Eine erfolgreiche Einstufung, welche das öffentliche Auftreten allerdings immer nur für einen bestimmten Zeitraum ermöglicht (das Vorspiel muss dementsprechend regelmäßig wiederholt werden), hängt für die hier vor allem betroffenen Amateurmusiker (im Gegensatz zum i. d. R. studierten Profimusiker mit entsprechendem Profistatus/-ausweis) außerdem vom bestehenden Beschäftigungsverhältnis (ein absolutes Muss in der DDR) bzw. von der im günstigen Fall wohlwollenden Zustimmung der jeweiligen Arbeitgeber ab. Dementsprechend sehen sich die Musiker nicht selten behördlicher Willkür und anderen Widrigkeiten ausgesetzt, so dass sie nun ihrerseits Strategien entwickeln, um damit das zum Teil völlig Unwägbare der Situation unterlaufen zu können. Neben einer, lediglich zum Schein arrangierten, tatsächlich aber kaum existierenden (und damit musikerfreundlichen) Arbeitsstelle wird in diesem Zusammenhang häufig ein auf künstlerischer Ebene greifendes doppeltes Spiel versucht, indem beispielsweise das jeweilige Musikprogramm von der Band selbst prophylaktisch in entschärfter Version mit entsprechend abgeänderten Texten etc. dem Einstufungsevent entsprechend anpasst vorgestellt wird, nur um es dann nach dem Erhalt der erwünschten Spielerlaubnis im Live-Kontext wiederum in der eigentlichen Originalversion aufführen zu können, womit schließlich das gesamte Einstufungsvorspiel ad absurdum geführt wird. Eine umgekehrte Version dieser Strategie betrifft die bewusste Installation von sogenannten Elefanten, das heißt von Textstellen, die ganz offensichtlich der Zensur zum Opfer fallen müssen, was dann wiederum von den eigentlich wichtigen, kritischen Passagen ablenken soll.Zum Einstufungssystem vgl. Michael Rauhut: Beat in der Grauzone. DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, Berlin 1993 (= BasisDruck Dokument 16), 42 ff.
Speziell mit Blick auf die Anderen Bands, welche größtenteils als Amateurbands/-musiker gelten und dementsprechend besonders betroffen sind, erscheint die Szene angesichts dieser Kontrollpraktiken allerdings zwiegespalten. Einige Bands betrachten die Situation aus einer eher pragmatischen Perspektive und unterziehen sich diesem notwendigen Übel (um überhaupt öffentlich in Erscheinung treten zu können). Andere wiederum lehnen ein Einstufungsvorspiel (und die damit verbundene Möglichkeit zur staatlichen Einflussnahme) als unzumutbaren Kompromiss schlichtweg ab und ziehen es vor, lediglich in privaten oder kirchlichen Zusammenhängen aufzutreten. Erst die finale Entwicklungsphase des Systems in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre – von Florian Lipp mit der Überschrift Erosion des EinstufungssystemsVgl. Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 392–414. versehen – bringt dann diverse Lockerungen (getragen vor allem von jüngeren, politisch offeneren und ästhetisch flexibleren Akteuren im Rahmen der Einstufungskommissionen, hauptsächlich in Berlin), die es auch systemkritischen oder sogenannten subversiven (bisher strikt unerwünschten) Bands erlauben, eine offizielle Spielerlaubnis zu erhalten, ohne weitere Anpassung oder Ausweichmanöver.
Zersetzung
Gemäß dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche steht allerdings drohend hinter der Spielerlaubnis immer auch das Spielverbot, welches vor allem in Verbindung mit den sogenannten Zersetzungsmaßnahmen der Staatssicherheit beispielsweise durch gezielte IM-Tätigkeit, auch innerhalb der Musikszene dazu dient, unerwünschte Erscheinungen auf Produktions- und Rezeptionsebene gleichermaßen auszuschalten.Zur Konzeption der Zersetzungsmaßnahmen durch die Staatssicherheit: „Offiziell eingeführt wurde es im Januar 1976 mit der Richtlinie Nr. I/76 über die Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge und beinhaltete ‚leise‘ (d. h. psychologische) Methoden, um Personen gezielt zu beeinträchtigen und zu schädigen, mit dem Ziel, dass sie daraufhin ihre Aktivitäten oder ihren Widerstand aufgaben.“ Katja Hoyer: Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990, Hamburg 2023, 372. Die Störung oder gar Zerstörung von Strukturen und nicht zuletzt von Menschen zumeist mit Hilfe von eingeschleusten und verdeckt agierenden inoffiziellen Mitarbeitern (IM) wird von Erich Mielke zunächst mit einer vorangegangenen feindlich-ideologischen Unterwanderung begründet, welche auch durch die unerwünschte Musik aus dem nichtsozialistischen Ausland vorangetrieben wird. Diesbezüglich „ersann der Stasi-Chef 1957 den Begriff der ‚politisch-ideologischen Diversion‘ (PID): Er glaubte, dass der Feind nicht mehr nur durch direkte Aktionen wie Terroranschläge, Aufwieglung und Bespitzelung versuchte, die Regierung der DDR zu stürzen, sondern auch durch die ideologische Unterwanderung ihrer Bürger. Durch westliche Musik, Tanz, Konsumgüter und Politik wurde die Bevölkerung und sogar Schlüsselpolitiker empfänglich für zersetzende Gedanken, die sie dann dazu nutzten, die Gesellschaft, welche die DDR aufzubauen versuchte, und das sozialistische System insgesamt zu untergraben.“Katja Hoyer: Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990, Hamburg 2023, 282 f. Die daraufhin realisierten (Gegen-)Maßnahmen, die operativen Vorgänge zur Infiltration von bestimmten Gruppierungen einer vermeintlich bereits infiltrierten (manipulierten) Bevölkerung, nehmen später im Zusammenhang mit den Anderen Bands vor allem hinsichtlich Ausmaß und Intensität zum Teil geradezu absurde Züge an. Dabei erscheint eine abschließende Bewertung der hier zentral erscheinenden Opfer-Täter-Relationen auch nach Jahrzehnten noch immer problematisch (gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene), was in den vielschichtigen Einzelfalldebatten beispielsweise zur Stasi-Tätigkeit von Sascha Anderson (IM-Decknamen: David Menzer, Fritz Müller, Peters) deutlich wird. Der extrem umtriebige und weitreichend im literarisch-musikalischen Untergrund der DDR vernetzte Dichter unterhält in den 1980er Jahren auch ganz konkrete Verbindungen zur Szene der Anderen Bands, wo er als Mitglied der 1979 gegründeten Band Zwitschermaschine (zusammen u. a. mit der Künstlerin Cornelia Schleime) aktiv ist und gleichzeitig als Stasi-IM über viele Jahre hinweg regelmäßig in konspirativen Treffen das gesammelte Insiderwissen an seine Führungsoffiziere weitergibt.Vgl. „Anderson“, ein Film von Annekatrin Hendel (mit Sascha Anderson u. a.), 2014. Wolf Biermann spricht diesbezüglich auch sehr deutlich vom „Schwätzer Sascha Arschloch, ein Stasispitzel, der immer noch cool den Musensohn spielt und hofft, daß seine Akten nie auftauchen. Das MfS setzte seine Kreaturen überall an die Spitze der Opposition, um sie besser abbrechen zu können.“Wolf Biermann: Der gräßliche Fatalismus der Geschichte, Dankrede zur Büchnerpreisverleihung 1991, https://www.deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/georg-buechner-preis/wolf-biermann/dankrede (30. 11. 2024).
Auch hinsichtlich der Anderen Bands sind es häufig gerade die unangepassten, für ihr antiautoritäres und selbstbestimmtes Auftreten gefeierten Szenegrößen wie beispielsweise Frank „Trötsch“ Tröger (Gründer der Band Die Firma, ab 1983, ein Bandname, der umgangssprachlich auch als Pseudonym für die Stasi gebraucht wird), Tatjana Besson (Bassistin und Sängerin der Band Die Firma, später bei Freygang) oder auch André Greiner-Pol (Gründer der Band Freygang, ab 1977), welche sich oft schon zu Beginn ihrer Karriere (wie auch immer motiviert) als Spitzel in ein langwieriges und aufreibendes Abhängigkeitsverhältnis zwischen Stasi und Szene haben einspannen lassen. Ihre besondere Stellung innerhalb der Szene, häufig in Verbindung mit einer existenziellen Notlage (Gefängnisaufenthalt, Krankheit o. ä.), macht sie für die Stasi interessant und zugleich angreifbar bzw. erpressbar, wobei die spätere IM-Tätigkeit dann wiederum auch den Status quo der rebellischen Musikerexistenz erhält, schützt oder gar intensiviert – ein absurder Kreislauf, der ohne den völligen Verlust der persönlichen Glaubwürdigkeit (gerade im alternativen Rockmusikgeschäft) kaum zu durchbrechen ist. Somit stellt sich beispielsweise Greiner-Pol erst in den späten 1990er Jahren den kritischen Fragen etwa von Musikwissenschaftler Michael Rauhut: „[Rauhut] Die drei klassischen Motive für eine Zusammenarbeit mit der Stasi waren Angst, Macht und Überzeugung. Welcher Hebel griff in deinem Fall? [Greiner-Pol] Ich hatte Angst. Aber es spielte auch ein gewisses Maß an Egoismus mit hinein. Ich habe Vor- und Nachteile abgewägt. Das war ein ganz pragmatisches Ding. Ich wollte meine Musik machen und nie wieder in den Knast.“[Michael Rauhut, André Greiner-Pol]: Simultanschach. André Greiner Pol über Stasi-Verstrickungen, in: André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 47–52, 48. Unter der Überschrift Auf Entzug, Die Akte „Benjamin Karo“ (so der IM-Deckname von Greiner-Pol) thematisiert Rauhut den von der Stasi in Gang gehaltenen „Teufelskreis aus Erpressung und Angst“Michael Rauhut: Auf Entzug. Die Akte „Benjamin Karo“, in: André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 40–46, 44. am Beispiel von Greiner-Pol, welcher sich jedoch nach einigen Jahren als IM der vermeintlichen Staatsallmacht durch wachsende Respektlosigkeit gegenüber den Funktionären und einer gehörigen Portion Renitenz ab 1981/82 entziehen kann, wenn auch ohne öffentliches Outing (was seine Karriere als Frontmann der Band Freygang zu dieser Zeit sicherlich beendet hätte):
„Am 20. August 1982 wird die Akte ‚Benjamin Karo‘ endgültig geschlossen. Als Grund gibt die Stasi an: ‚Zum IM besteht seit Mai 1981 keine Verbindung mehr. Vereinbarte Treffs wurden von ihm grundsätzlich nicht mehr wahrgenommen.‘ Weiter heißt es: ‚Es kann angenommen werden, daß der IM sich bewußt einer Zusammenarbeit mit dem MfS entzieht und nur solange an einem Kontakt interessiert war, solange er für sich persönliche Vorteile erhoffte.‘“Michael Rauhut: Auf Entzug. Die Akte „Benjamin Karo“, in: André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 40–46, 46.
(Um-)Erziehung
Gemäß der eingangs angeführten „Relationalität der Macht“ (Foucault) lässt sich gerade am Beispiel von André Greiner Pol sehr gut der fragile Balanceakt nachvollziehen, der hier die Gesamtsituation immer wieder kippen lässt und in beständiger Bewegung hält, und zwar auf ganzer Linie zwischen den Positionen Macht und Ohnmacht, das heißt zwischen dem totalitären Machtanspruch des Staates und dem zunehmenden (später totalen) Kontrollverlust der Staatsorgane bzw. zwischen der künstlerisch-individuellen Selbstermächtigung und dem aktenkundigen Verrat an der eigenen Sache. Dies gilt gleichermaßen für die politisch motivierte „weltfremde Umerziehungsprogrammatik“, die neben dem „ausgeprägten Sicherheits- und Machtdenken“ als ein weiterer Aspekt des „kulturbürokratischen Apparates“Peter Wicke: Zwischen Förderung und Reglementierung – Rockmusik im System der DDR-Kulturbürokratie, in: ders., Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 11–27, 17. in diesem Zusammenhang eine bedeutende Rolle spielt. Auch hier zeigt sich eine wechselseitig relativierende Einflussnahme als Feedback-Loop zwischen Politik und Kunst – eine kulturtheoretische Perspektive, die bereits in der antiken Philosophie zu finden ist, wo gerade die musikalische Praxis als Werkzeug oder Medium zwischen Staatsmacht und individueller Persönlichkeitsentwicklung eine konkrete erzieherische Funktion zu erfüllen hat und dementsprechend auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene von größter Bedeutung ist. In seiner Schrift Der Staat (Politeia, drittes Buch) entfaltet Platon (bzw. Sokrates im Dialog mit Glaukon) mit Blick auf die richtige Ausbildung der Wächter (Militär) im Idealstaat seine Auffassung von Musik und gibt an, dass „die Erziehung vor allem in der Musik“Platon: Der Staat, eingeleitet, übersetzt und erklärt von Karl Vretska, Stuttgart 2015 (= Universal-Bibliothek 8205), 184 (402a). ruht und darum „[…] ist die Erziehung durch die Musik so überaus wichtig, weil am tiefsten in die Seele Rhythmus und Harmonie eindringen, sie am stärksten ergreifen und ihr edle Haltung verleihen: solch edle Haltung erzeugen sie, wenn man richtig erzogen wird, wenn nicht, dann die entgegengesetzte.“Platon: Der Staat, eingeleitet, übersetzt und erklärt von Karl Vretska, Stuttgart 2015 (= Universal-Bibliothek 8205), 183 (401d–e). Und schlussfolgernd heißt es weiter: „Vor einer Musikerneuerung muß man sich hüten, sonst rüttelt man am Ganzen! Nirgends rüttelt man an den Gesetzen der Musik, ohne an die wichtigsten politischen Gesetze zu rühren […].“Platon: Der Staat, eingeleitet, übersetzt und erklärt von Karl Vretska, Stuttgart 2015 (= Universal-Bibliothek 8205), 211 (424c).
Diese besondere Sorge vor allem um die Jugend des Landes „als Gestalter der Zukunft“Bodo Mrozek: Jugend Pop Kultur. Eine transnationale Geschichte, Berlin 2019 (= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 2237), 124. wird auch von den verantwortlichen Kulturfunktionären der DDR geteilt. Die Angst vor den vermeintlich schadhaften Einflüssen einer schier unaufhaltsamen populären Musikkultur aus dem nichtsozialistischen Ausland ist bereits seit den 1960er Jahren ein beständiger und zum Teil gar federführender Begleiter auf zahlreichen Parteitagen, Plenartagungen oder Komiteesitzungen (die gewaltsamen Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Westberlin-Konzert der Rolling Stones am 15. September 1965 dienen den Genossen hier oft als willkommener Aufhänger). Dabei erscheint das Verhältnis zwischen westlicher Beatmusik und Staatsmacht noch bis in die erste Hälfte der 1960er Jahre hinein relativ entspannt, was anhand von Veröffentlichungen wie dem AMIGA-Sampler Big Beat (I und II) aus den Jahren 1964/1965 (mit Produktionen von DDR-Bands wie den Sputniks, den Butlers oder dem Franke-Echo-Quintett u. a.) oder der ersten AMIGA-Lizenz-LP der Beatles (1965) sichtbar wird. Auch die Gründung von DT 64 (zunächst mit dem Jugendstudio als Radiosendung, später dann als Jugendradiosender der DDR on air) im Rahmen des Deutschlandtreffens der Jugend 1964 zeugt von dieser (zumindest temporären) Liberalisierungstendenz.Zu diesen frühen Aufbrüchen vgl. Michael Rauhut: Beat in der Grauzone. DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, Berlin 1993 (= BasisDruck Dokument 16), 49 ff. Erst das Jahr 1965 stellt diesbezüglich eine Zäsur dar. Mit dem sogenannten Kahlschlag-Plenum (11. Plenum des ZK der SED) vom 15. bis 18. Dezember 1965 und der vorangegangenen Niederschlagung der Beat-Krawalle am 31. Oktober 1965 in Leipzig (bekannt als die Schlacht auf dem Leuschnerplatz) stellt die Staatsführung die Weichen für einen verschärften Kurs „gegen die Nachahmer der sogenannten amerikanischen Lebensweise“Margot Honecker, zit. n. Katja Hoyer: Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990, Hamburg 2023, 272., denn schließlich geht es hier niemals lediglich um Musik allein, sondern immer auch um die Bruchstellen an denen Musik aufhört bzw. anfängt Politik zu sein (Musik als Waffe im Klassenkampf). Dementsprechend wird mit dem Jahr 1965 auch bereits das „Ende des Tauwetters“Katja Hoyer: Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990, Hamburg 2023, 271. angesetzt, während Michael Rauhut die schwerwiegenden Folgen der politischen Entscheidungen gar als „Plenumsdruckwelle“Michael Rauhut: Rock in der DDR 1964 bis 1989, Bonn 2002 (= ZeitBilder), 36. beschreibt. Neben der öffentlichen Diffamierung von Beatfans (Halbstarke, Rowdys, Asoziale) werden rigoros Verbote verhängt (Entzug der Spielerlaubnis auf unbestimmte Zeit), die zahlreichen Bands das Handwerk legen sollen. Doch viele der hiervon betroffenen Musiker bleiben auch weiterhin in immer neuen Formationen aktiv, bis sich die Szene wieder zu stabilisieren beginnt und trotz oder vielmehr mit den staatlichen Restriktionen weiter wächst, wie man am Beispiel der bereits erwähnten Butlers aus Leipzig sehen kann, deren turbulente Bandgeschichte auf sehr eindrucksvolle Weise auch die kulturpolitischen Entwicklungslinien und Wandlungen dieses Zeitraums reflektiert: 1958 gründet Klaus Jentzsch zunächst die Klaus Renft Combo, deren Verbot 1962 zu The Butlers führt (der englische Artikel wird später aus dem Bandnamen entfernt, da er aus der Sicht der Kulturfunktionäre auf sprachlicher Ebene den Klassenfeind repräsentiert). Im Oktober 1965 erfolgt dann das Verbot der Butlers (im Zusammenhang mit dem erwähnten politischen Kurswechsel) und der langjährige Übergang zur Neuformierung der Klaus Renft Combo, später schlicht Renft genannt – eine der erfolgreichsten Rockbands der DDR, welche dann wiederum 1975 verboten wird.Als sehr eindrucksvolles Zeitdokument gilt diesbezüglich der Film „Seitenwechsel“ (1977) von Olaf Leitner (mit Klaus Jentzsch, nach dessen Ausreise in die BRD/West-Berlin 1976), der als westdeutscher Musikjournalist auch eines der ersten Bücher über den DDRock (Leitner) verfasst: Rockszene DDR. Aspekte einer Massenkultur im Sozialismus, Reinbek bei Hamburg 1983 (= rororo 7646).
Doch selbst aus staatlicher Perspektive funktionieren die verhängten Verbote langfristig dann allerdings ebenso wenig wie der parallel anlaufende Versuch, die Bevölkerung mit hauseigenen Musikformaten zu unterhalten oder gar zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen. Gemäß der Forderung Wir müssen etwas Besseres bieten! (Walter Ulbricht, erste Bitterfelder Konferenz 1959Mit den beiden Bitterfelder Konferenzen 1959 und 1964 wird der Versuch unternommen, eine eigene, sozialistische Kulturpolitik auf den sogenannten Bitterfelder Weg zu bringen.) soll es eine sozialistische Tanz- und Unterhaltungskunst (also eine Kunst der Unterhaltung) geben, welche jenseits der Unterhaltungs- und Konsumwaren einer profitorientierten kapitalistischen Kulturindustrie vielmehr der eigenen, sozialistischen Lebenswelt entspricht und diese künstlerisch reflektiert bzw. an der Erschaffung dieser Lebenswelt aktiv mitwirkt.Zur vergleichbaren Konzeption des Sozialistischen Realismus in der Musik, vgl. Walther Siegmund-Schultze: Theorie und Methode des sozialistischen Realismus in der Musik, in: Siegfried Bimberg, Werner Kaden, Eberhard Lippold, Klaus Mehner, Walther Siegmund-Schultze (Hg.): Handbuch der Musikästhetik, 2. Auflage, Leipzig 1986, 149–183. Die staatliche Anregung und Förderung einer solch passenden (volkseigenen) und entsprechend kontrollierbaren Kunst soll schließlich auch auf dem U-Musiksektor über den reinen Unterhaltungswert hinaus insbesondere der sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung dienen.Vgl. David Tompkins: Musik zur Schaffung des neuen sozialistischen Menschen: Offizielle Musikpolitik des Zentralkommitees [sic] der SED in der DDR in den 50er Jahren, in: Tillmann Bendikowski, Sabine Gillmann, Christian Jansen, Markus Leniger, Dirk Pöppmann (Hg.): Die Macht der Töne. Musik als Mittel politischer Identitätsstiftung im 20. Jahrhundert, Münster 2003, 105–113. Ganz in diesem Sinne vermittelt auch der Titel einer frühen DEFA-Dokumentation über die Singebewegung der DDR bzw. den Oktoberklub – Lieder machen Leute„Lieder machen Leute“, Regie: Gitta Nickel, DEFA-Studio für Dokumentarfilme 1968 (erschienen auf DVD in der Reihe Die DDR in Originalaufnahmen, Singeklubs in der DDR). – die hoffnungsvollen Bemühungen um eine Jugend, die sich zwar durchaus eigenständig mit Ihrer Welt auseinandersetzten und dies auch auf musikalischem Wege kommunizieren soll, allerdings ohne dabei die staatlichen Rahmenbedingungen und politischen Zielsetzungen aus dem Blick zu verlieren oder gar grundsätzlich in Frage zu stellen. So entstehen zahlreiche Gitarrengruppen und Singeklubs, die häufig vom DDR-Jugendverband FDJ (Freie Deutsche Jugend) organisiert werden und mit großflächiger Unterstützung der DDR-Medien tatsächlich auch nennenswerte Erfolge verzeichnen können. Zu den bekanntesten Formationen zählen hier unter anderem die Brigade Feuerstein (gegründet als Singeklub Hoyerswerda u. a. mit Gerhard „Gundi“ Gundermann) und vor allem der Oktoberklub (gegründet bereits 1966 als Hootenanny-Klub in Ostberlin)Zur Vereinnahmung und Instrumentalisierung von Singebewegung und Oktoberklub durch verschiedene Instanzen der Kulturpolitik, siehe Bettina Wegner (Gründungsmitglied des Hootenanny-Klubs und spätere Liedermacherin) im Film „Bettina“ von Lutz Pehnert, 2022 (DVD/2023). mit seiner frühen Hit-Single Sag mir, wo du stehst (1967), einer Komposition von Klub-Mitglied Hartmut König (später Mitglied des ZK der SED und 1989 gar stellvertretender Minister für Kultur) frei nach dem Song Which Side Are You On? (1931) von Florence Reece – ein äußerst geschichtsträchtiges Lied, welches nochmals über zwanzig Jahre später als Coverversion im Dunstkreis der Anderen Bands (Naiv, 1989) erneut erklingt, wobei die politische Aussage des dabei nur minimal abgeänderten Textes aufgrund der völlig veränderten gesellschaftlichen Umstände der Wendezeit eine gänzlich neue Ausrichtung erfährt und sich das Lied nun wiederum als Protestsong mit ironischem Unterton gegen die alten, bereits überholten Verhältnisse singen lässt.
Aneignung
Vergleichbar mit den Druckschwankungen der Schallausbreitung auf molekularer Ebene (Kompression/Dekompression) vollzieht die kulturpolitische Ausrichtung der DDR bezüglich der inländischen Rockmusikentwicklung mehrfache Kurswechsel zwischen einer negativ-ablehnenden (wie beispielsweise nach 1965) und einer tendenziell eher positiv-annehmenden Grundhaltung. So präsentiert sich die DDR nach dem Machtwechsel 1971 (Walter Ulbricht wird von Erich Honecker abgelöst) bzw. im Vorfeld der X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Ostberlin 1973 insbesondere in den Augen und Ohren der Weltöffentlichkeit als tolerant und liberal, was schließlich auch in den Bereich der Rockmusik hineinwirkt. Die hierbei als pragmatisch oder gar als eigennützig erscheinende (oft beiderseitige) Kompromissbereitschaft erweitert nun zumindest für eine gewisse Zeit den produktionsästhetischen Möglichkeitsraum, innerhalb welchem sich Bands wie beispielsweise die Puhdys, Panta Rhei, Bayon, Renft und City national und international zu erfolgreichen Acts entwickeln können (welche dem Staat nicht nur positive mediale Aufmerksamkeit verschaffen, sondern auch die dringend benötigten Devisen einspielen).Eine kritische Darstellung dieser Ereignisse findet sich in der Autobiographie von Wolf Biermann. Siehe ders.: Warte nicht auf bessre Zeiten! Die Autobiographie, Berlin 2016, 275 ff. So entsteht seit den frühen 1970er Jahren erstmals eine relativ eigenständige, zumeist deutschsprachigeDie auch von staatlicher Seite gewünschte oder gar verordnete Verwendung der deutschen Sprache soll zunächst dazu dienen, den Einflussbereich der englischsprachigen Klassenfeinde auf musikalischer Ebene einzuschränken. Tatsächlich erweist sich der beinahe flächendeckende Gebrauch des Deutschen in der Rockmusik der DDR jedoch bereits in den 1970er Jahren (und später ebenso hinsichtlich der Anderen Bands) als besonders geeignete Ausdrucksform zur möglichen Kommunikation auch von gesellschaftlichen bzw. systemkritischen Tabuthemen – man versteht es, vor allem im Rahmen der Muttersprache auch zwischen den Zeilen zu texten bzw. zu lesen. DDR-Rockmusik, die aufgrund der unvermeidlichen staatlichen Einflussnahme durchaus auch als domestiziert bezeichnet werden kann, wobei die tiefgreifende Musik-Staat-Relation, die Peter Wicke bereits in den 1980er Jahren unter der Teilüberschrift Aneignung beschreibt, perspektivisch sowohl positive als auch negative Aspekte erkennen lässt:
„Eine große Rolle für die Herausbildung und Entwicklung eines eigenen Profils der DDR-Rockmusik spielten die sie tragenden Organisationsformen und Leitungsmethoden. Durch die Art und Weise der Organisation ihrer Produktion und Verbreitung, ihrer gesellschaftlichen Förderung und ihrer kulturpolitischen Leitung als Bestandteil des sozialistischen Kulturprozesses wurde ihr jene soziale Wirksamkeit erschlossen, die sie immer näher an die Lebenspraxis Jugendlicher in der DDR heranführte, was sich dann umgekehrt in einer wachsenden Eigenständigkeit ihrer Entwicklung niederschlug. Andererseits sahen sich die Musikanten vor diesem Hintergrund immer wieder mit Forderungen konfrontiert, die sie zur Auseinandersetzung zwangen, zur Überprüfung ihrer Positionen oder zum engagierten Eintreten für ihre Sache, auf jeden Fall aber zu einer wachsenden Bewußtheit in ihrer Funktion und ihrer Verantwortung in der Gesellschaft veranlaßten.“Peter Wicke: Anatomie des Rock, Leipzig 1987, 177.
Spätestens nach einer weiteren Welle staatlicher Repressalien in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre (Renft-Verbot 1975, Biermann-Ausbürgerung 1976 u. a.) erscheint diese zweckgebundene Symbiose dann jedoch in zunehmendem Maße problematisch oder gar unhaltbar. Die von Wicke 1987 noch positiv dargestellte, fruchtbare Wechselwirkung zwischen staatlicher Organisationsform, Musikproduktion und jugendlicher Lebenspraxis muss spätestens dann völlig zum Erliegen kommen, wenn sich die mittlerweile fest im System etablierten und professionalisierten Bands in erster Linie um das Erreichen bzw. den Erhalt ihrer möglichen Privilegien (regelmäßige Plattenaufnahmen, Rundfunk- und TV-Präsenz, Konzertreisen ins nichtsozialistische Ausland, teures Equipment etc.) kümmern und dabei den eigenen Erfolg letztlich an den Menschen im Land vorbei verwalten (lassen). Und auch wenn im sogenannten Profilager immer wieder großartige und ernstzunehmende Bands wie beispielsweise Silly oder Pankow für etwas frischeren Wind sorgen, so ist doch der Stillstand und der damit einhergehende tendenzielle Bedeutungsverlust der staatlich geprüften Profirockbands vor allem in den 1980er Jahren klar erkennbar. Die hier entstehende Leerstelle wird schließlich von neu aufkommenden Bands besetzt, die zwar ebenfalls nie gänzlich unabhängig vom System existieren (können), aber dennoch immer wieder verstärkt und zum Teil sehr erfolgreich auch jenseits der staatlichen Organisationsformen agieren und später unter der durchaus verschiedenartig interpretierbaren Bezeichnung Die Anderen Bands Bekanntheit erlangen. Gerade die Vieldeutigkeit dieses Labels kann allerdings leicht in die Irre führen, da es oberflächlich betrachtet eine gewisse Fremdheit andeutet (importierte/imitierte Musik aus dem nichtsozialistischen Ausland o. ä.), während die hier zusammengefassten Bands tatsächlich jedoch eine musikalische Entwicklung vertreten, welche in ganz besonderem Maße auf das Engste mit den gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen in der DDR verbunden ist und diese (direkt oder indirekt) reflektiert, verarbeitet und schließlich rückwirkend mitgestaltet – eine tiefgreifende Korrelation, welche es im Folgenden einzugrenzen und schwerpunktartig zu benennen gilt. Denn gerade aus heutiger Perspektive erscheinen vor allem diese Anderen Bands – auch da wo sie zunächst als Opposition auftreten oder tatsächlich internationale Entwicklungen aufgreifen (und oftmals den realsozialistischen Gegebenheiten entsprechend auf eigene Art weiterführen) – als die eigentliche DDR-Rockmusikkultur, deren Bedeutung sich unter anderem auch am wachsenden wissenschaftlichen Interesse festmachen lässt.
III. Lieder machen Leute machen Lieder
Selbstermächtigung
„Das Kartenhaus fällt ein, das ist uns einerlei. Der Staat ging uns schon immer am Arsch vorbei […].“Textbeginn des Songs „Das Kartenhaus“ der Band Freygang (E. Kenner/A. Greiner-Pol) von 1990, vgl. Freygang XXX Songs 1977–2007, Berlin 2007, 34. – singt André Greiner-Pol als Frontmann der von ihm 1977 gegründeten Bluesrockband Freygang (hier jedoch bereits im Wendejahr 1990), und zwar vor allem im Rückblick auf die eigene Grundhaltung im nun einfallenden Kartenhaus DDR (und darüber hinaus auch bereits hinsichtlich der bevorstehenden BRD). Diese zunächst sehr direkt und scheinbar unmissverständlich formulierte Ansage lässt sich jedoch angesichts der tatsächlichen Bandgeschichte so zunächst nicht unbedingt bestätigen, da gerade der Werdegang von Freygang (und damit untrennbar verknüpft der persönliche Lebensweg von Greiner-Pol) gemäß der oben beschriebenen „Relationalität der Macht“ (Foucault) insbesondere durch den beständigen Konflikt zwischen der Band und den Institutionen bzw. Repräsentanten des Staates geprägt erscheint. Die hierbei auszumachende Wechselwirkung manifestiert sich einerseits in polizeilichen Maßregelungen und vor allem in den mehrfach erfolgten, gestaffelten Spielverboten (1981 Entzug der Spielerlaubnis für ein Jahr, 1983 Spielverbot für zwei Jahre, 1986 dann das finale Spielverbot auf Lebenszeit). Andererseits besteht der für DDR-Verhältnisse enorme Erfolg der Band, welcher mit jedem Verbot anwächst und dabei fast ausschließlich auf der intensiven, von Freygang größtenteils selbständig organisierten (mal legalen, mal wieder illegalen) Konzerttätigkeit beruht. Zur Legende wird die Band jedoch in jenen Jahren erst durch das Zutun der Staatsmacht, deren unwirksame (letztlich gar kontraproduktive) Verbotspolitik der Band eine fast schon mythische Aura verleiht und sie schließlich zum Symbol für die Möglichkeit einer alternativen Existenz im diktierten Realsozialismus aufsteigen lässt.Mit Blick auf diese Form der kulturpolitischen Wechselwirkung heißt es in der „Populärballade“ von Wolf Biermann: „Ihr löscht das Feuer mit Benzin, Ihr löscht den Brand nicht mehr, Ihr macht was Ihr verhindern wollt: Ihr macht mich populär.“ Ders.: Warte nicht auf bessre Zeiten! Die Autobiographie, Berlin 2016, 180. Dabei verbreitet sich der Ruf der Band von Beginn an jenseits der offiziellen Staatsmedien von Mund zu Mund oder mittels illegaler Live-Mitschnitte und zieht so Mitte der 1980er Jahre zum Teil tausende Fans zu den Veranstaltungen quer durch die gesamte DDR. Nach den frühen, von existenzieller Selbstbehauptung geprägten Jahren, zeugt die spätere Phase dann (durchaus auch dem Erfolg entsprechend) bereits von einer antiautoritären Respektlosigkeit gegenüber den zunehmend ohnmächtig wirkenden Staatsorganen, was die am Ende auf Lebenszeit verbotene Band schließlich 1987 unter dem Decknamen OK Band gar auf eine Tournee entlang der Erdgastrasse durch die Sowjetunion führt – ein renitenter Aktionismus, der sich in der Wendezeit in Form von Hausbesetzungen, politischen Initiativen (Autonome Aktion Wydoks) oder neugeschaffenen Veranstaltungsräumen (Eimer) fortsetzt.Vgl. Die Freygang-Biographie/Freygang Katalog, in: André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 303–309.
Grundsätzlich erscheint hier neben der machtbezogenen Wechselwirkung das Moment der fortschreitenden Selbstorganisation und damit einhergehend der Prozess der individuellen Selbstermächtigung exemplarisch und kennzeichnend für die gesamte Szene der Anderen Bands. So beschreibt Susanne Binas (musikalisch aktiv in der Band Der Expander des Fortschritts) unter dem Titel Die „anderen Bands“ und ihre Kassettenproduktionen weitere Aspekte einer, hier nun vor allem medienbasierten Selbstorganisation von Bands wie AG Geige, Die Art oder Kaltfront:
„Zentralisierte politische und ökonomische Machtverhältnisse streben in Ihrer Erhaltungslogik totale Kontrolle an. Sie entwickeln dafür entsprechende Systeme, Instanzen und Medien […]. […] In einem solchen System konnte auch Kultur nur organisiert gedacht werden. Trotzdem lassen sich nachweisbar Phänomene rekonstruieren, die am Rande der durch das System gesetzten Legalität in selbstorganisierten Formen existieren.“Susanne Binas: Die „anderen Bands“ und ihre Kassettenproduktionen – Zwischen organisiertem Kulturbetrieb und selbstorganisierten Kulturformen, in: Peter Wicke, Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 48–60, 48.
Die auf immer breiterer Ebene Verwendung findenden neuen Medien zur Aufnahme, Speicherung und Verbreitung von Musik hinterlassen in den 1980er Jahren auch in der DDR tiefgreifende Spuren (Stichwort Demokratisierung der Produktionsmittel). Kostengünstigere Audiotechnologien beispielsweise zur Kassettenproduktion (Proberaum- oder Konzertmitschnitte, vertrieben über ein inoffizielles Home-Label mit zumeist direktem Band-Bezug„Viele der spät oder gar nicht bei Amiga zu einer Veröffentlichung gekommenen Bands hatten ihre eigenen Home-Labels: Die Art hatte Hartmut Productions in Leipzig, AG Geige seit 1985 KlangFarbe, die Dresdner Band Kaltfront seit 1987 die ZIEH-DICH-WARM-AN-TAPES, das Freie Orchester aus Berlin seit 1986 die Krötenkassetten.“ Susanne Binas: Die „anderen Bands“ und ihre Kassettenproduktionen – Zwischen organisiertem Kulturbetrieb und selbstorganisierten Kulturformen, in: Peter Wicke, Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 48–60, 56.) ermöglichen mobile, dynamische und vor allem relativ autonome Produktions- und Distributionsstrukturen, welche die Musik, ohne den langwierigen und in vielen Fällen von vornherein unmöglichen Umweg über die Staatsmedien, ungefiltert und unkontrolliert, in immer weiter greifenden Kreisen, direkt von den Bands zum Publikum transferieren.Dementsprechend zirkuliert auch in jüngeren Publikationen die Bezeichnung Magnetbanduntergrund. Vgl. Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023. Einher geht diese eigenmächtige (inoffizielle/illegale) Verbreitung von Ton-, Bild- oder Textmaterialien immer auch mit einer äußerst erfindungsreichen, der Zensur und der Mangelwirtschaft entgegenwirkenden Improvisationskunst im weiteren Design-Bereich der Fanartikel, welche als DIY-Kultur beispielsweise die Gestaltung von musikbezogenen Mode-Accessoires beinhaltet. Die Monopolstellung des Staates wird somit sukzessive auf vielen Ebenen unterlaufen und die damit einhergehenden Veränderungen zeigen sich rasch und betreffen über den Bereich der Musik hinaus schließlich weitere grundlegende Entwicklungsaspekte einer sich in zunehmendem Maße verselbständigenden Gesellschaft (bis hin zum MauerfallIn diesem Sinne beantwortet auch Michael Rauhut die Frage „Brachte Rockmusik die Mauer ins Wanken?“ durchaus positiv: „Statt das System zu stabilisieren, diente Rockmusik vielfach als ein emanzipatorisches Medium, durch das Widerstand und Wandel erlebbar wurden. Im kulturellen Gebrauch dieser Musik etablieren sich alternative Sozialisations- und Kommunikationsmuster, die dem staatlichen Erziehungsanspruch zuwiderliefen.“ Ders.: Raus aus der Spur. Brachte Rockmusik die Mauer ins Wanken?, in: Dominik Schrage, Holger Schwetter, Anne-Kathrin Hoklas (Hg.): „Zeiten des Aufbruchs“ – Populäre Musik als Medium gesellschaftlichen Wandels, Wiesbaden 2019 (= Auditive Vergesellschaftungen Hörsinn – Audiotechnik – Musikerleben), 183–202, 198.).
Dabei erscheinen die hier greifenden Prozesse hinsichtlich der Anderen Bands nur selten schwarz-weiß, legal oder illegal, offiziell oder inoffiziell, sondern vielmehr zwischen den Extremen durchaus fließend. Ganz im Sinne asiatischer Kampfsportarten zeigen sich die Musikschaffenden oft durchaus gewillt, auch die Kräfte des Gegners zu nutzen, um damit dann allerdings in erster Linie den eigenen Interessen folgend auf ihren Wegen voranzukommen, ohne sich dabei, was die individuelle Geisteshaltung anbelangt, gänzlich verbiegen zu müssen – ein durchaus risikoreicher, zuweilen mit dem Vorwurf der opportunistischen Korruption konfrontierter, kulturpolitischer Balanceakt, den allerdings zahlreiche Bands bereit waren einzugehen und auszuhalten. Der Kompromiss beginnt hier im Grunde bereits mit dem Absolvieren der oben beschriebenen Einstufung (zum Erhalt der Spielerlaubnis im öffentlichen Raum) – eine staatliche Kontrollinstanz, die von einigen als notwendiges Übel akzeptiert, von anderen wiederum als unzumutbare Einflussnahme grundsätzlich abgelehnt wird (was jedoch zur Folge hat, dass die betroffenen Bands lediglich noch im privaten Kontext oder unter dem Dach der Kirche auftreten können). Exemplarisch erscheint dieser Konflikt abgebildet beispielsweise im Werdegang der Band Rosa Extra, die sich in den späten 1970er Jahren „als avantgardistisch-literarische Punk-Band“Ronald Galenza: Was mir deine Schleuder ist dir meine Waschmaschine. Von Rosa Extra zu Hard Pop, in: Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023, 67–91, 70. In die alternative Literaturszene hinein spielt Rosa Extra/Hard Pop auch mit musikalischen Beiträgen zur Lyrik-Publikation „Ich fühle mich in Grenzen wohl“ (1986) von Bert Papenfuß-Gorek, Stefan Döring, Sascha Anderson und Jan Faktor. um den für die Szene wichtigen Musiker und Bandleader Günter Spalda zu formieren beginnt und sich zunächst ohne staatliche Einstufung durchschlägt, diese dann aber 1984 nachholt, was sogleich die zwangsweise Umbenennung der Band in Hard Pop zur Folge hat (Rosa Extra ist in der DDR der Name einer Damenbinde und erscheint den offiziellen Hütern der realsozialistischen Kulturstandards in diesem Zusammenhang unangemessen bzw. unzumutbar).Vergleichbar mit der Umbenennung der Band Die Zucht in Die Art im Rahmen ihres offiziellen Einstufungsverfahrens 1985. Unter neuem Namen eingestuft und zugelassen sind nun nicht nur öffentliche Konzerte möglich, sondern auch Plattenaufnahmen und Radio-Airplay, was am Ende jedoch nichts daran ändert, dass Hard Pop im beständigen Spiel der Machtverhältnisse verboten wird und Spalda „1987 ziemlich entnervt von den staatlichen Kultur-Verwesern“Ronald Galenza: Was mir deine Schleuder ist dir meine Waschmaschine. Von Rosa Extra zu Hard Pop, in: Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023, 67–91, 88. einen Ausreiseantrag stellt und wie so viele das Land verlässt.
Hinsichtlich dieser prägenden Korrelation zwischen Bands und Staat schreibt Susanne Binas zusammenfassend, dass „sich diese Szene einer eindeutigen Zuordnung entweder zum organisierten Kulturbetrieb oder zu den selbstorganisierten Kulturformen entzieht, vielmehr in einem ambivalenten ‚Dazwischen‘ angesiedelt war.“Susanne Binas: Die „anderen Bands“ und ihre Kassettenproduktionen – Zwischen organisiertem Kulturbetrieb und selbstorganisierten Kulturformen, in: Peter Wicke, Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 48–60, 48. Die jeweilige Selbstorganisation kann hier je nach Kompromissbereitschaft der Entscheidungsträger auch die offiziellen Kanäle einbeziehen, womit die grundsätzlich gegebene Autonomiebestrebung oft auch an ganz pragmatische Abwägungen gebunden bleibt – eine Bindung, die von Wilhelm Schmid in seinem Buch Philosophie der Lebenskunst unter der Überschrift Lebenskunst und Machtstrukturen angeführt wird, um damit bereits auf existenzieller bzw. persönlicher Ebene gerade die zweckgerichtete Dynamik möglicher Veränderungen kenntlich zu machen, „an deren Realisierung die Individuen alltäglich mit pragmatischer Autonomie selbst arbeiten können.“Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 155. Und weiter heißt es bei Schmid mit Blick auf die Umbruchsituation in der Sowjetunion (Glasnost und Perestroika) und dem hier ebenfalls ausschlaggebenden Prozess der Selbstermächtigung: „Die auf Selbstmächtigkeit gegründete individuelle Macht konstituiert die Macht von unten, die sich zudem in Form von Kooperationsnetzen und Solidargemeinschaften (Interessengruppen, Verbände, Bürgerinitiativen, gesellschaftliche Bewegungen) als soziale Macht organisiert. Keine Macht von oben, auch nicht eine totalitäre, kann auf Dauer auf die Akzeptanz, die individuelle wie die soziale, von unten verzichten.“Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 153. Diese Form der auf individueller Selbstermächtigung beruhenden Selbstmächtigkeit betrifft nun auch auf kollektiver Ebene die musikalische Praxis der Anderen Bands und erscheint letztlich ebenso als eine stetige Anverwandlung von Lebenswelt, wobei das diktierte Weltbild der Nomenklatura sukzessive im Hintergrund verblasst und sich dafür vordergründig vermehrt Freiräume öffnen, die nun bespielt werden können.
Es gibt dein richtiges Leben im falschen!
Auch wenn es bekanntermaßen bei Adorno mit kritischem Blick auf die beschädigte Privatexistenz in der Moderne heißt „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“Theodor W. Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt a. M. 1980 (= Gesammelte Schriften 4), Nr. 18 „Asyl für Obdachlose“, 42 f., 43., so ist doch jenseits der theoretischen Reflexion eine Relativierung dieser rigorosen Festschreibung in jedem Fall notwendig, da es weder ein absolut richtiges noch ein absolut falsches Leben geben kann.Zur Relativierung der Aussage durch Adorno selbst, siehe Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 48. Allerdings könnte man das Zitat auch als einen Hinweis zur grundsätzlichen Ausrichtung der Lebensführung auffassen, welcher dann möglicherweise als zielgerichteter Impuls die individuelle Suche nach einem richtigen Leben im Sinne einer weitestgehend eigenständigen, erfüllten und selbstverantwortlichen Existenz anzuregen vermag – ein Leben, das als persönlicher Möglichkeitsraum auch innerhalb der Zwangsvorgaben einer Diktatur begrenzt realisierbar erscheint. Die Umformulierung Es gibt dein richtiges Leben im falschen! entspricht somit eher einer positiv begründeten Hoffnung, da „[d]as einzelne Individuum […] mit seinem Versuch eines richtigen selbst zum Korrektiv des falschen Lebens [wird].“Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 48.
Das auch hier greifende „Spiel der Macht“Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 154. lässt nun insbesondere im diktatorisch geprägten System immer auch die „Umkehrbarkeit von Machtbeziehungen“Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 154. erkennen, was unter anderem durch die Lebensweise zahlreicher Künstler, Musiker oder Szene-Persönlichkeiten gerade im Zusammenhang mit den Anderen Bands deutlich wird. Exemplarisch lässt sich hier vor allem die 1983 von Alexander „Aljoscha“ Rompe (zusammen mit Christian „Flake“ Lorenz und Paul Landers) gegründete Band Feeling B anführen, deren Auftreten die Verhältnisse auf den Kopf stellt und die Gemüter in Bewegung versetzt – kein rockmusikalisches Unterhaltungsprogramm, brav isoliert dargeboten von 20 bis 22 Uhr, sondern die gemeinsam gestartete Große Action (Rompe) von Band und Publikum, die aus der teilweise improvisierten und experimentellen Kombination von Mobilität (mit unterschiedlichsten Verkehrsmitteln quer durchs Land reisen und irgendwo übernachten), Kommunikation (Leute treffen, sich austauschen, Kontakte knüpfen) und Party besteht. Zusammengehalten wird diese Mixtur von einer Musik, die hochgradig ansteckend ist und dabei einflussreicher als so mancher Parteibeschluss zu einem anderen Leben anstiftet. Titel wie beispielsweise Frusti, machs gut und Geh zurück in dein Buch oder Mix mir einen Drink (der mich woanders hinbringt, mit den Textzeilen „Ich will nicht mehr bleiben unter diesen Leichen, die mir ihre weichen Hände reichen“) sind Aufrufe zur Selbstermächtigung, Lieder zum Abschied vom teilweise selbstverschuldeten Zonenalltag, aber nicht mit dem üblichen Blick in Richtung Westen – hier wird vor der eigenen Haustür getanzt. Dabei erscheint dieser klingende Aufstand (zumindest vordergründig) nicht als politisch motivierte Bewegung gegen den Staat, sondern zunächst vielmehr auf ganz persönlicher Ebene als ein Aufwachen und Erheben (der eigenen Stimme und Stimmung) im Sinne einer Selbstaktivierung, was dann möglicherweise wiederum positiv auf die unmittelbare, oft spießig normierte Umgebung abfärbt (so zumindest die Hoffnung). Der staatliche Wind, der beständig zu stark von vorne weht, die vorgefassten Klippen der Bürokratie etc., all dies muss nicht allzeit bekämpft werden, sondern lässt sich auch trickreich umschiffen – man muss sich nicht konstant auf Konfrontationskurs halten, um dann im Gegenwind auf hoher See zu erfrieren – so die Grundaussage des Songs Am Horizont.Die hier angeführten Titel erscheinen noch im Januar 1990 auf einer der ersten Punk-Langspielplatten der DDR („Hea Hoa Hoa Hea Hea Hoa“) via AMIGA. Das dementsprechende Ausscheren aus der vorgegebenen Spur wird dabei gar von staatlicher Seite noch abgefedert. Der geringe ökonomische Druck erlaubt es (eventuell mit einem Schein-Job für die Augen und Ohren der Staatssicherheit), auch mit sehr geringen finanziellen Mitteln ein durchaus selbstbestimmtes, nicht allein vom Arbeitsalltag diktiertes Leben zu führen. Die enge Verbindung von Aljoscha RompeZu Aljoscha Rompe (1947–2000) bleibt anzumerken, dass der umtriebige Organisator und Strippenzieher gesellschaftlich eine extreme Sonderstellung einnimmt: Aufgewachsen als wohlbehütetes Kind der Elite in Ost-Berlin entdeckt Rompe aufgrund einer Erbschaftsangelegenheit, dass sein gerader verstorbener (bis dahin unbekannter) leiblicher Vater Schweizer Staatsbürger war und er demnach ein Anrecht auf einen Schweizer Pass hat, den er 1978 auch bekommt, die DDR daraufhin aber nicht verlässt, sondern schnell enttäuscht vom Westen forthin eine Ausnahme-Existenz im Osten führt. und der Band Feeling B mit der alternativen Lebensgemeinschaft auf der Ostseeinsel Hiddensee zeugt von diesem individuellen Möglichkeitsraum, welcher in dem Roman Kruso (2014) von Lutz Seiler dargestellt wird (auch mit ganz konkreten Bezügen zu Aljoscha Rompe alias Losch bzw. zu Feeling B, ohne diese jedoch direkt zu benennen).
Mit derartigen Botschaften, verpackt in einer explosiven Mischung aus chaotischem Punk und hitverdächtiger Kantabilität, trifft die Band Mitte der 1980er Jahre den richtigen Nerv vieler Zeitgenossen, wobei insbesondere die direkte, grundsätzlich auf Deutsch verfasste Ansprache im Rahmen der alltäglichen Lebenswelt der Menschen verstärkt resoniert und so die verfestigten Verhältnisse lockert oder gar erweitert. In diesem Sinne schreiben auch die Augen- und Ohrenzeugen Ronald Galenza und Heinz Havemeister:
„Der Feeling B-Spaßdampfer war eine immerwährende Party. Sie beherrschten die Partisanentaktik, tauchten als Guerillatruppe plötzlich irgendwo auf, verzauberten ihre Umgebung und konnten sich unvermutet wieder zurückziehen. Vieles wurde in der Kontrollgesellschaft dadurch möglich. Feeling B war ein weithin sichtbarer Leuchtturm in düsteren Zeiten, sie schlugen eine Bresche für die nachfolgenden ‚anderen Bands‘. Feeling B hat mit ihrer Haltung, ihren zeitlosen Liedern unfreiwillig auch den ehemaligen DDR-Untergrund parodiert. Die Band lebte alkoholgetränkte Lebensfreude pur, Macht und Szene-Intrigen ignorierte sie dabei. Sie pfiffen auf zwanghaftes Protestverhalten, sie lebten ihren Protest. Sie legten ihren musikalischen Schneidbrenner an die Nervenbahnen des sozialistischen Kulturbetriebes und zündeten ihre Protuberanzen des Punk. […] Dabei wirkte Feeling B unbewusst weit über die Musikszene hinaus, wurde die Band doch mit ihrer Haltung und Lebensweise zum Modell für viele von ihrem Leben enttäuschte Jugendliche. Aljoscha war unausgesprochen der gewiefte Gegen-Pädagoge, der weit mehr Einfluss ausübte als normierte Elternhäuser und das durchdisziplinierte Schulsystem der DDR.“Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Geh zurück in dein Buch. Vorwort, in: dies.: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 10–17, 13 f.
Die hier angedeutete Erfüllung einer bedeutenden sozialen Funktion basiert demnach vor allem auf dem konkreten Gebrauch der Musik innerhalb der individuellen Lebenssituation, womit immer auch bereits das Alltägliche zum Politikum avanciert (was nun wiederum die Staatsmacht mit ängstlicher Vorsicht verstärkt an die perfide Kontrolle gerade der Privatbereiche bindet) – eine kulturpolitische Dimension, die nun allerdings weit über das Wirken von Feeling B und den Anderen Bands hinausgeht. So schreibt Peter Wicke passend mit Blick auf die Funktion von Populärer Musik insgesamt: „In dieser integrierten Form […] erfüllt die Musik nun eine entscheidende Funktion – sie fungiert als Medium für die Umsetzung sozialer Erfahrungen in ‚persönlichen Sinn‘.“Peter Wicke: „Populäre Musik“ als theoretisches Konzept, in: PopScriptum 1/92, 21.
Provinz (eine un-ordentliche Ausweitung der Kampfzone)
Kaum eine Arbeit zum Thema alternative Rockmusik in der DDR kommt ohne die ostdeutsche Provinz bzw. die geographische Peripherie jenseits der verwaltungstechnischen Schalt- und Überwachungszentrale Berlin aus. Spätestens seit den 1970er Jahren etabliert zunächst vor allem die Blues-SzeneVgl. Michael Rauhut, Thomas Kochan (Hg.): Bye bye, Lübben City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2018. diverse Spielstätten fernab von jedem großstädtischen Kulturbetrieb. Völlig unbekannte Ortschaften mit schlichtem Landgasthof und Dorftanzsaal geraten nun regelmäßig in den Fokus der musikalischen Live-Aktivitäten und entwickeln sich dabei teilweise zu regelrechten Pilgerorten mit entsprechendem Kultstatus für die aus der ganzen Republik oft sehr zahlreich anreisende Fangemeinde. Darüber hinaus werden immer wieder auch größere Volks- und Heimatfeste wie beispielsweise der Weimarer Zwiebelmarkt oder der Wasunger Karneval (Thüringen) praktisch gekapert und zu Szene-Treffen umfunktioniert, und zwar häufig sehr zum Ärger von Politik, Volkspolizei und so manchem schwer entrüsteten Staatsbürger.Siehe auch 1000-Jahrfeier, Altenburg 1976, oder Pressefest, Erfurt 1978, vgl. Jan Schönfelder: Gitarren und Knarren, Krawall auf dem Erfurter Pressefest 1978, in: Michael Rauhut, Thomas Kochan (Hg.): Bye bye, Lübben City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2018, 225–240. Aber gerade da, wo die Staatsmacht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, diese subkulturellen Happenings zu verhindern, zeigt sich wiederholt die enorme Widerstandskraft und der trickreiche Einfallsreichtum der Szene. So wird beispielsweise im Umfeld des Wasunger Karnevals jahrelang der Versuch unternommen, Menschen, die gemäß ihrer Haartracht, Kleidung etc. von der Polizei oder der Staatssicherheit als unerwünschte (negativ-dekadente) Zielpersonen identifiziert werden, auf den Zugstrecken oder den Zufahrtsstraßen in Richtung Wasungen an der Weiterfahrt zu hindern – letztlich jedoch ohne großflächigen Erfolg. Die Szene (er-)findet auch in diesem Kontext beharrlich ihre eigenen (Um-)Wege und entwickelt in der Gegenbewegung ihrerseits situative Strategien und Taktiken, um die einmal gewonnen Freiräume zu behaupten und schließlich umso ausgelassener zu feiern.Vgl. Daniel Weißbrodt: Karneval in Wasungen. Das Volksfest als subkulturelles Happening, in: Michael Rauhut, Thomas Kochan (Hg.): Bye bye, Lübben City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2018, 306–320.
Im Hinblick auf die Anderen Bands kann diese konkrete Raumnahme exemplarisch an verschiedenartigen Organisationsformaten festgemacht werden. Da wäre beispielsweise das Dorf Lugau (im Süden von Brandenburg) und Alexander Kühne, der als einheimischer in seinem popkulturell eher unattraktiven Heimatdorf um 1984 mit einer Gruppe von Gleichgesinnten beginnt, im Rahmen des selbstverwalteten Jugendklubs Extrem eine Veranstaltungsreihe zu organisieren und hierfür über Jahre hinweg beinahe alle wichtigen Bands der Szene wie beispielsweise Feeling B, Sandow oder Die Art (aber auch Bands ohne Spielerlaubnis oder gar eine Band aus Westberlin) in der Lugauer Dorfgaststätte auftreten lässt.Vgl. Ronald Galenza: Lugau – Wie Punk aufs Dorf kam, in: ders., Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013, 348–353. Mit diesen sehr erfolgreichen Events (von offizieller Seite teilweise als Verstöße gegen die sozialistische Moral abgebrochen oder untersagt) sollen Dorf, Kneipe und vor allem die Beteiligten selbst in einen durch die Kunst verwandelten offenen Raum ohne Grenzen und Tabus (Kühne) entlassen werden – ein großer Transformationsversuch, der insbesondere durch die publizistische Arbeit von Alexander Kühne im Gespräch bleibt, welcher seine Erfahrungen in dem Roman Düsterbusch City Lights (2016) verarbeitet und in zahlreichen Dokumentationen vermittelt (siehe beispielsweise Lugau City Lights, Ein DDR-Dorf schreibt Popgeschichte, 2018). Ein weiteres Format wird in dem nordthüringischen Dorf Steinbrücken entwickelt, wo Uwe Hager als der hauptverantwortliche Organisator einen für DDR-Verhältnisse einzigartigen Ortswandel bewirkt, indem er das Seinbrücken-FestivalVgl. Karen Kolbe-Döhring, Frank Döhring (Hg.): Freiheit, Blues und Scherben. Geschichten eines Musikfestivals, Dresden 2021. ins Leben ruft (zunächst schlicht als Privatfeier angemeldet, da Privatpersonen keine öffentlichen Veranstaltungen organisieren dürfen), welches regelmäßig einmal im Jahr zu Pfingsten stattfindet und zumindest für kurze Zeit einen ver- und entrückten Open-Air-Freistaat im Staat bildet:
„1985 haben wir in Steinbrücken in einem abgelegenen, tollen Tal mit den Konzerten angefangen. Die erste Band war Pasch, eine lokale Band aus Thüringen, bei der war André Greiner-Pol Sänger [aufgrund des Freygang-Verbots anderweitig beschäftigt, Anm. d. Verf.] Beim ersten Mal waren 200 Leute da, jeder musste einen Hunderter Eintritt abdrücken, dafür war drei Tage lang alles Essen und Trinken frei. Das Jahr darauf kamen schon tausend Leute. Freygang hat gespielt und sie brachten noch Die Firma mit. So habe ich Paul und Flake 1986 kennengelernt, Aljoscha kannte ich noch nicht. […] Wir freundeten uns gleich gut an, sie haben bei mir auf dem Hof gewohnt. Sie sagten, nächstes Jahr spielen wir aber mit Feeling B in Steinbrücken [gesagt und ab 1987 auch wiederholt getan, Anm. d. Verf.].“Uwe Hager im Kapitel: Alles ist so dufte. Steinbrücken, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 175–183, 175.
Noch eine weitere Spielart der alternativen Kulturorganisation stellt die von Ronald Galenza, Lars Wünsche und Eberhard Fischel veranstaltete Konzertreihe X-Mal! Musik zur Zeit dar, welche ab 1986 ausgehend von dem Jugendklub Pablo Neruda auf der Insel der Jugend in Berlin-Treptow (später u. a. auch im Kreiskulturhaus Treptow) zahlreichen, vor allem noch unbekannten Bands der Szene (Die Art, die anderen, WK 13, Sandow, Ornament & Verbrechen, Die Vision, Der Demokratische Konsum, Kaltfront, Das Freie Orchester, Cadavre Exquis, Herbst in Peking, AG Geige, Der Expander des Fortschritts, Wartburgs für Walter, Ichfunktion, Tausend Tonnen Obst, Tina Has Never Had A Teddy Bear) eine Bühne bietet:
„Bei der Akquise für die regelmäßigen Konzerte nutzten Wünsche & Co. erstaunlich ähnliche Methoden wie die seit 1984 [eigentlich seit 1981, seit 1984 dann mit spezieller Hinwendung zum lokalen Nachwuchs, Anm. d. Verf.] in Leipzig tätige IG Rock [Interessengemeinschaft Rock, Anm. d. Verf.]. Über ein Kontaktenetzwerk wurden Bands erreicht, die sich gerade erst im Proberaum eingerichtet hatten und so konnte man viele Talente als erste präsentieren. Auch für das DDR-interne Problem mit den obligatorischen staatlichen Spielerlaubnissen wurde ein Workflow geschaffen. Jungen Bands wurde eine Ausnahme-Auftrittsgenehmigung besorgt und das folgende öffentliche Konzert konnte gleich für eine ‚Einstufung‘ genutzt [werden]. Danach stand, bei entsprechend beiderseitiger Geschmeidigkeit, weiteren Auftritten nichts mehr entgegen. Dennoch fanden auch einzelne Konzerte nicht eingestufter Bands unter Tarn-Namen statt […].“Lutz Schramm: X-Mal! Musik zur Zeit, Parocktikum Wiki: https://paroktikum.de/wiki/index.php?title=X-Mal!_Musik_zur_Zeit (23. 10. 2024).
Die aktive und relativ unabhängige Teilhabe an diesen Veranstaltungen, das Planen, Kontaktieren, Mobilisieren, Durchführen, Scheitern und die erneuten Anläufe – all dies erscheint auf einer ganz existenziellen Ebene für alle Beteiligten beinahe überlebenswichtig und sinnstiftend, in einem Land, zu dessen Führung und Ideologie diese Menschen zum Teil bereits auf größtmögliche Distanz gegangen sind, das sie aber nicht verlassen, sondern in ihrem Sinne für sich gestalten wollen. Dabei findet diese Art der frei-willigen Kulturorganisation (die es abseits der offiziellen Institutionen eigentlich gar nicht geben darf) grundsätzlich in einer rechtlichen Grauzone statt, mit Schlupflöchern zwischen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Die von den jeweiligen Veranstaltern oft ganz bewusst verdunkelte Mixtur aus verwaltungstechnischer Legalität und Illegalität und der (zumindest für die Augen der Behörden) extrem undurchsichtige Wildwuchs an Beziehungen und Netzwerken zwischen Veranstaltern, Fans und Bands (selbst zwischen befreundeten Bands wie Feeling B, Freygang und Die Firma, mit einem regen Austausch an Bandmitgliedern), sind für die Staatsmacht kaum mehr nachvollziehbar, vielerorts unfassbar und somit auch nicht verhinderbar. Die sich dadurch immer erfolgreicher gestaltende Übernahme von konkreten Orten (Ordnungen) und deren Raum-Werdung – Raum als ein gelebter Ort„Insgesamt ist der Raum ein Ort, mit dem man etwas macht.“ Michel de Certeau: Kunst des Handelns, Berlin 1988, 218. – durch die mannigfaltigen Praktiken der Szene, wird von Michel de Certeau in seinem Buch Kunst des Handelns unter der Überschrift Populäre Kulturen in einem allgemeinen Sinn wie folgt verdeutlicht:
„[…] eine Umgangsweise mit aufgezwungenen Systemen führt zum Widerstand gegen das historische Gesetz eines tatsächlichen Zustandes und gegen seine dogmatischen Legitimationen. Die Benutzung einer von anderen geschaffenen Ordnung führt zu einer Neuaufteilung des Raumes in dieser Ordnung; sie schafft zumindest einen Spielraum für die Bewegung von ungleichen Kräften […].“Michel de Certeau: Kunst des Handelns, Berlin 1988, 59.
Die individuelle Selbstermächtigung geht hier nun als Kollektivleistung fließend über, in eine Aneignung von vorgefundenen Infrastrukturen, die nun anverwandelt als relational-dynamische Handlungsräume rückwirkend die Szene mittragen und somit den oben beschriebenen staatlich-institutionellen „Linien und […] Kristallisierungen“ (Foucault) entgegenwirken. Der hier greifende Feedback-Loop begründet schließlich die zunehmende Handlungsfreiheit der Szene auf der einen, und die wachsende Ohnmacht der Staatsorgane auf der anderen Seite: „Die Macht ist ein Phänomen des Kontinuums. Sie verschafft dem Machthaber einen weiten Raum des Selbst. Diese Logik der Macht erklärt, warum der totale Machtverlust als ein absoluter Raumverlust erfahren wird.“Byung-Chul Han: Was ist Macht?, Stuttgart 2005 (= Universal-Bibliothek 18356), 15. Der erweiterte „Raum des Selbst“ erscheint dabei als die eigentliche Grundessenz der erstarkenden Wirkungsmacht der Anderen Bands und speist kontinuierlich die un-ordentliche Ausweitung ihrer jeweiligen Kampfzonen.
Vereinnahmung (polydirektional)
Angesichts der weitgreifenden institutionellen Macht- und Kontrollverluste, werden vor allem in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre von staatlicher Seite aus auch auf dem Gebiet der Popkultur verspätete und zum Teil eher hilflos anmutende Versuche unternommen, die anwachsende Distanz zwischen der Staatsführung und den Menschen im Land zu verringern (es soll dosiert Dampf aus dem bereits unruhig erhitzen Kessel abgelassen werden).Vgl. Der Politbürobeschluss von 1988 und seine Folgen, in: Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 414–453. Hierbei kommt es zu punktuellen Lockerungen, die es ermöglichen, dass Weltstars aus dem nichtsozialistischen Ausland wie beispielsweise Bob Dylan (1987), Joe Cocker (1988) oder Bruce Springsteen (1988) nun auch live in der DDR zu hören sind.Vgl. Joachim Hentschel: Dann sind wir Helden. Wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde, Hamburg 2022. Im Gegenzug erhalten ab Frühjahr 1989 auch einige (wenige) Vertreter der Anderen Bands die Erlaubnis, in West-Berlin, der BRD und ab 1990 auch im weiteren nichtsozialistischen AuslandVom 18. bis 25. Januar 1990 sind Musiker (Feeling B, Die Firma, Die Art, AG Geige, Sandow) und Künstler der alternativen DDR-Szene „als Kultur-Botschafter in der Kunst-Metropole Paris zu Gast. Der DDR-Kunstwissenschaftler Christoph Tannert war der Zaubermeister, er hatte den französischen Kulturminister Jack Lang mit dem Charme und der Exotik des ostdeutschen Kultur-Untergrundes verhext.“ Ronald Galenza und Heinz Havemeister im Kapitel: Eure Zukunft, die wird euch jagen. Paris, in: dies.: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 272–281, 272. aufzutreten (für finanziell erfolgreiche Profibands längst Alltag). So spielen Feeling B, die anderen und Tina Has Never Had A Teddybear gemeinsam ihr erstes Konzert in West-Berlin (im Schöneberger Extasy) am 26. Mai 1989.Zum West-Berlin-Konzert von Feeling B und die anderen 9. November 1989 (im Kreuzberger Pike) vgl. im Kapitel: Ich such die DDR. Die Wende, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 242–271, 242–244. Darüber hinaus gewährt man einer Auswahl von Vertretern der hauseigenen alternativen Szene den bisher versagt gebliebenen Zugang zu den zentralen Produktions-, Distributions- oder Kommunikationsmedien. Bands, die bisher kaum nennenswerte Beachtung (von der Überwachung durch die Staatssicherheit einmal abgesehen) bzw. Unterstützung erfahren haben, sehen sich plötzlich in die Lage versetzt, ihre Musik im professionellen Rahmen zu produzieren und über das DDR-Label AMIGAAls ein Teil des VEB Deutsche Schallplatten Berlin verantwortlich für die Veröffentlichung von zeitgenössischer Unterhaltungsmusik (Rock, Pop, Schlager, Jazz, Blues etc.). zu veröffentlichen, was wiederum Radio-Airplay und Artikel in Fachzeitschriften etc. zur Folge hat. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die oben beschriebene Raumnahme auch die großen Medieninstitutionen des Landes betrifft, wo nun neben treuen Staatsdienern auch vermehrt Akteure anzutreffen sind, die der alternativen Musikszene weitaus näher stehen als der Nomenklatura (oder gar selbst Teil der Szene sind) und nun im Rahmen ihrer jeweiligen Positionen durchaus eigenverantwortlich Formate schaffen und Inhalte vermitteln, die auch auf musikalischer Ebene den vorgegebenen Rahmen sprengen oder zumindest stark erweitern. Dementsprechend muss die vorangestellte Teilüberschrift perspektivisch relativiert werden. Die verbreitete Auffassung eines großangelegten staatlichen Vereinnahmungsversuchs (eventuell vergleichbar mit der unter Aneignung beschriebenen Domestisierungstendenz in den frühen 1970er Jahren) erscheint in dieser Spätphase der DDR bereits angesichts der fortgeschrittenen Autonomie und Omnipräsenz der Szene als unrealistisch. Auch lässt sich auf keiner Seite eine „bewusste Vereinnahmungsstrategie“Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 485. ausmachen. Erst auf der Ebene der konkreten Einzelfälle erscheint es wiederum möglich, zumindest von einer versuchten, polydirektionalen Vereinnahmung zu sprechen, welche in zunehmendem Umfang jedoch von der Szene selbst vorangetrieben wird und schließlich auch auf medialer Ebene einer aktiven Raumnahme (hier buchstäblich auf Kosten der staatlichen Institutionen) bzw. der damit einhergehenden Erweiterung der künstlerischen Einflusssphäre im öffentlichen Raum entspricht.
In diesem Zusammenhang erscheint insbesondere die Pionierarbeit von Lutz Schramm bedeutend, welcher 1986 als Moderator im neugegründeten Jugendradiosender DT 64 (vorher lediglich Jugendprogramm) die Sendung Parocktikum startet und damit der Jugend des Landes auf breiter Ebene neben internationalen Titeln insbesondere den alternativen DDR-Sound näher bringt und dabei auch eingereichte Eigenproduktionen von Bands ohne Spielerlaubnis (also auch ohne sonstige Öffentlichkeit) berücksichtigt:
„Hier eröffnete sich ein für DDR-Verhältnisse neuartiger Kommunikationsraum. Schramm übernahm dabei weniger die Rolle des Initiators und Impulsgebers. Vielmehr ließ dieser sich von Anfang an von der Nachfrage jugendlicher Hörer leiten, griff Vorschläge und Wünsche auf und versuchte diese innerhalb der gegebenen Grenzen umzusetzen. Das Paroktikum ging dabei weit über den ‚eigentlichen‘ Zweck einer Radiosendung, nämlich das Abspielen von Musik, hinaus: Die Sendung wurde DDR-weit Anlaufpunkt für Fans außergewöhnlicher, ‚schräger‘ Musik, vom Punk in der Provinz bis zum FDJ-Sekretär in der Hauptstadt. Zwischen diesen divergierenden Gruppen funktionierte das Paroktikum auf den Feldern der Musikproduktion und des Veranstaltungswesens als Vermittlungsinstanz und kompensierte so Leerstellen der dysfunktionalen Kulturbürokratie.“Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 484.
Über die Musikvermittlung hinaus agiert Schramm auch als Produzent bzw. Aufnahmeleiter im Rahmen der Paroktikum-Sessions (Rundfunk der DDR),Neben dem VEB Deutsche Schallplatten Berlin, gilt der Rundfunk der DDR als bedeutender Musikproduzent in der DDR (verstärkt durch die Zunahme von privaten Homerecording-Studios in den 1980er Jahren als dritte Produktionskraft, allerdings von eher ungeklärtem Rechtsstatus). wobei erste Aufnahmen von AG Geige, Kaltfront oder Der Expander des Fortschritts und Live-Mitschnitte von Feeling B, Sandow oder Die Skeptiker zustande kommen.Vgl. Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 378–380. Einige der von Schramm produzierten und/oder in der Sendung vorgestellten Titel schaffen dann auch den Sprung auf die gleichnamige Langspielplatte Paroktikum, die anderen bands, welche jedoch erst 1989 bei AMIGA erscheint, größtenteils aber die jeweiligen Rundfunkaufnahmen präsentiert (mit einer Ausnahme, die den Song Unter dem Pflaster von Feeling B betrifft und laut LP-Hülle aus dem DEFA-Dokfilmstudio stammt): Hard Pop (Katjuscha), Die Skeptiker (Egal), Feeling B (Unter dem Pflaster), Zorn (Touristen), Rosengarten (Bessere Zeiten), Die Art (Sie sagte), Sandow (Schweigen und Parolen), die anderen (Gelbe Worte), AG Geige (Die Möbiusband/Zeychen und Wunder), Der Expander des Fortschritts (Der fremde Freund), Cadavre exquis (Tränen von Soweto), Hard Pop (Schlaflied).Siehe Neuveröffentlichung (2023) der unveränderten Original-LP durch SECHZEHNZEHN Musikproduktion (über Buschfunk erhältlich).
Etwas eingeschränkter, zumindest was die repräsentative Vielfalt anbelangt, erscheint dagegen das Programm einer weiteren AMIGA-Publikation, die schon 1988 im Rahmen der bereits etablierten Reihe Kleeblatt (Nr. 23)Insgesamt eine Testreihe vor allem für jüngere Bands, denen die Plattenfirma noch keine umfangreichere LP-Produktion zutraut. unter dem Titel die anderen Bands erscheint und Feeling B (Artig, Alles ist so dufte, Geh zurück in dein Buch), Hard Pop (Grau, Tote Ballerina, Angst vom Mund), Sandow (Wir?, Fliegen, Er ist anders) und WK 13 (P2, Asphalt, Sonntag) beinhaltet.Siehe Neuveröffentlichung (2023) der unveränderten Original-LP durch SECHZEHNZEHN Musikproduktion (über Buschfunk erhältlich). Diese beiden Sampler bleiben allerdings bis zum Mauerfall im November 1989 die einzigen offiziellen Publikationen der Szene (in der DDREine andere, über die Grenzen der DDR hinausführende Geschichte, die an dieser Stelle jedoch nicht ausgeführt werden kann, erzählen die in der Bundesrepublik bzw. in West-Berlin erfolgten Materialveröffentlichungen wie beispielsweise auf der Split-LP „DDR von unten/eNDe“ (Aggressive Rockproduktionen, 1983) mit den beiden Bands Zwitschermaschine und Schleim-Keim (unter dem Pseudonym Sau-Kerle), nachzulesen u. a. in folgender Publikation: Kein Ende mit „eNDe“. Zur Geschichte von „DDR von Unten“. In den Worten von Dimitri Hegemann und Karl-Ulrich Walterbach, sowie des MfS, gesammelt und arrangiert von Alexander Pehlemann, in: Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023, 93–106.). Erst ab Anfang 1990 veröffentlicht AMIGA weiteres Material im LP-Format beispielsweise von AG Geige (Trickbeat, 1989), DEKAdance (Happy Birthday, 1989), Feeling B (Hea Hoa Hoa Hea Hea Hoa, 1990)Eine detaillierte Schilderung der für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlichen Produktionsumstände findet sich im Kapitel: Lass dir nicht erzählen, was du zu lassen hast. Amiga & Westtouren, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 224–241. Siehe auch die Neuveröffentlichung (2023) der unveränderten Original-LP (im Doppelpack mit dem zweiten Feeling B-Album „Wir kriegen euch alle“ von 1991) durch SECHZEHNZEHN Musikproduktion (über Buschfunk erhältlich). oder Sandow (Stationen einer Sucht, 1990) – Alben, deren Songs (die zum Teil lange vor der Wende entstanden sind) allerdings für viele Jugendliche längst zum individuellen Musikalltag gehören. Auch das mediale Echo in den Fachzeitschriften Medoldie und Rhythmus oder Unterhaltungskunst hält sich zwischen 1986 und 1990 durchaus in Grenzen. Dabei sind es wiederum vor allem Leute aus der Szene selbst bzw. Kenner oder Unterstützer wie Jürgen Balitzki, Lutz Schramm, Jürgen Winkler und Ronald Galenza, die hier erste Artikel beispielsweise im Rahmen der Serie Die neuen Bands (Unterhaltungskunst, ab Februar 1988 bis Juli 1990) veröffentlichen.Vgl. Lutz Schramm: Die neuen Bands, Parocktikum Wiki: https://paroktikum.de/wiki/index.php?title=Die_neuen_Bands (29. 10. 2024). Noch überschaubarer nimmt sich die Präsenz der Anderen Bands im Film- und TV-Bereich aus, allerdings mit einer herausragenden Ausnahme – im Oktober 1988 hat der DEFA-Dokumentarfilm flüstern & SCHREIEN, ein Rockreport Premiere und läuft anschließend vielbeachtet in den Kinos. Der Film vermittelt ein lebhaft-buntes Bild, weniger der DDR-Rockmusikszene in Gänze (wie der Untertitel möglicherweise vermuten lässt), als vielmehr vor allem hinsichtlich des medialen Zusammenschnitts von routinierten Profibands und Musikern bzw. Fans der alternativen Szene. Dabei hat das DEFA-Produktionsteam, bestehend aus Dieter Schumann (Regie), Jochen Wisotzki (Drehbuch) und Michael Lösche (Kamera), ursprünglich (die Arbeiten beginnen bereits 1986) keine der später im Film auftretenden Anderen Bands vorgesehen (und zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht einmal gekannt). Eingeplant sind zunächst lediglich die bereits etablierten Bands Silly und Chicorée. Erst während der Produktion kommt es dann zu eher zufälligen Begegnungen mit Aljoscha Rompe (Feeling B) und Kai Uwe Kohlschmidt (Sandow). Die beiden Bandleader verstehen es hierbei, ihre Bands quasi von der Seitenlinie aus geschickt ins Spiel zu bringen und das Filmteam davon zu überzeugen, dass es gerade die junge alternative Musikszene ist, die als zeitgemäße, popkulturelle Bereicherung zentral in den Film gehört, womit sie wiederum auf Seiten der Produktionsleitung auf offene Ohren, viel Sympathie und Gegenliebe stoßen, so dass der Film am Ende tatsächlich so wirkt, als hätten die Verantwortlichen von Beginn an vor allem die alternative Szene im Sinn gehabt.Vgl. u. a. das Kapitel: flüstern & SCHREIEN. Ein Rockreport, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 184–199. Gezeigt werden beispielsweise Mitglieder der Band Sandow, die während einer Fahrt mit der Deutschen Reichsbahn ihre Banderfahrungen erörtern oder mit dem Fahrrad querfeldein in Richtung Ostsee radeln, auf der Suche nach Auftrittsmöglichkeiten, Schlafplätzen und Partys. Feeling B wird beim Strandkonzert mit integrierter Suppenküche gefilmt. Im Gegenzug sieht man den Profis von Silly auf großer Bühne, mit teuerstem Equipment, beim Soundcheck zu. Dieser, für den Film so charakteristische, künstlerische und kulturpolitische Spannungsbogen wird dabei vor allem durch die zu Wort kommenden Fans und Musiker der alternativen Szene getragen, deren eigenwillige, selbstbewusst-kritische und zugleich positiv-agile Ausstrahlung „einen starken musikalisch-konzeptionellen und sozialen Gegenpol“Jochen Wisotzki im Kapitel: flüstern & SCHREIEN. Ein Rockreport, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 184–199, 189. zum musikalischen Profilager und darüber hinaus zum sozialistischen Lebensmodel darstellt.Der Film ist als DVD erhältlich oder in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung einsehbar: https://www.bpb.de/mediathek/video/264590/fluestern-und-schreien/ (3. 11. 2024).
Auch wenn sich hier die staatliche Einflussnahme scheinbar in (offensichtlich bereits deutlich geweiteten) Grenzen hält, so ist dennoch davon auszugehen, dass das Produktionsteam an die bestehenden kulturpolitischen Rahmenbedingungen des Medienunternehmens DEFA gebunden ist und sich somit auf inhaltlicher Ebene beständig zwischen noch möglichen, eventuell möglichen und unmöglichen Ideen, Filmmaterialien etc. entscheiden muss – für viele Kreative in der DDR ein äußerst aufreibender Balanceakt, welcher zumeist mit einer grundsätzlich abwägenden und vorausschauenden Vorsicht bezüglich möglicher, die Produktion gefährdender Konsequenzen verbunden ist. Dennoch bekommt der Zuschauer einen durchaus realitätsnahen Eindruck unter anderem von den oben beschriebenen Szene-Grundzügen der Selbstorganisation bzw. der individuellen Selbstermächtigung und der damit verbundenen, übergreifenden Raumnahme. Dabei erscheint nun gerade die Produktion des Films selbst, aufgrund der ungeplant-spontanen Teilvereinnahmung durch die Anderen Bands, ebenfalls als gutes Beispiel für die Ausweitung der Handlungsräume auf medialer Ebene. Zugleich werden innerhalb der Szene jedoch auch kritische Stimmen laut, welche sowohl mit Blick auf flüstern & SCHREIEN als auch hinsichtlich der oben angeführten AMIGA-Produktionen (oder vergleichbar staatsnahen Aktivitäten wie beispielsweise der Teilnahme von Sandow, DEKAdance und Die Skeptiker an der FDJ-Werkstattwoche Jugendtanzmusik 1988 in Suhl) einen Ausverkauf mit entsprechendem Unabhängigkeits- bzw. Glaubwürdigkeitsverlust, oder gar eine final „tödliche Umarmung“„Viele standen in einem inneren Zwiespalt zwischen dem ersehnten Zugriff auf Auftritts- und Produktionsmöglichkeiten und der damit verbundenen Gefahr, die tödliche Umarmung von Seiten des Kulturapparats zu erleiden, wie Kohlschmidt von Sandow es rückblickend im Interview formulierte.“ Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 430. konstatieren, da auch diese neuen Spielräume, solange sie auf im Grunde unvermeidlichen Kompromissen basieren, letztlich noch immer im Kontroll- und Einflussbereich der Staatsmacht verbleiben (müssen).Zur Kritik und dem damit einhergehenden „Käuflichkeitsvorwurf“ vgl. Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 442–446.
Die Anderen (dem Namen nach)
Als Begriff (auf der inhaltsbezogenen Bedeutungsebene) lässt sich die zusammenfassende Bezeichnung Die Andern Bands sowohl aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte als auch hinsichtlich ihrer relativen Offenheit durchaus verschiedenartig auffassen und wird dementsprechend in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen gemäß der jeweiligen Motivation oder dem zugrundeliegenden Erkenntnisinteresse auch unterschiedlich verwendet. Aus einer eher allgemein gehaltenen und weit gefassten Perspektive betrachtet, steht das Andere der hier bezeichneten Anderen häufig zunächst stellvertretend für eine andersartige Kultur, welche die künstlerische Ebene und die grundsätzliche Geisteshaltung bzw. Lebensführung der jeweiligen Akteure gleichermaßen betrifft – die Musik und das Leben der AnderenAuch der Titel des Films „Das Leben der Anderen“ von Florian Henkel von Donnersmarck (2006) vermittelt dieses Motiv hinsichtlich der Konfliktsituation zwischen Staatsmacht, Staatssicherheit und Bevölkerung (hier mit speziellem Fokus auf Theatermachern und Literaten). als tönende Opposition zur staatlich geförderten Rockkultur, zum staatsbürgerlichen Spießertum und zur einheitsgrauen Staatsdoktrin – eine Auffassung, die mit Blick auf das weiter oben beschriebene „ambivalente Dazwischen“ (Binas), allerdings nicht in Gänze zutrifft, da sich die jeweilige Selbstorganisation dieser musikalisch motivierten Gegenbewegung im Sinne der „pragmatischen Autonomie“ (Schmid) immer wieder auch mit dem staatlichen Kulturapparat verbindet. Auf einer eher individuellen Ebene erscheint das Andere dann wiederum bezeichnend für die identitätsstiftende Selbstabgrenzung vor allem von Jugendlichen oder Jugendgruppen innerhalb einer für sie inakzeptablen Gesellschaftsordnung oder Lebenssituation (ganz im Sinne des Sandow-Songs Er ist anders, mit den bekannten Textzeilen „Er ist anders als all die andern, und er will auch anders sein, er ist anders als all die andern, doch er fühlt sich zu sehr allein.“) Doch erst die engere musikhistorische Perspektive zeigt schließlich die konkrete Begriffsgenese, und zwar ausgehend von der 1985 gegründeten Band die anderen (durchgehend klein geschrieben), deren Bandname letztlich fremdgesteuert über Umwege auf die Szene übergeht:
„Dieser Stil [eine Mischung aus Ska und Pop mit Punk-Appeal, Anm. d. Verf.] war schon in unserem Bandnamen begründet. die anderen meinte soviel, den ganzen anderen musikalischen Rest gibt es ja auch noch. Uns ging es mit dem Namen nicht so sehr darum, sich irgendwie besonders gegen andere abzusetzen.“Olaf Tost in: Intellektuelle und Spaßrabauken. Interview mit Olaf „Toster“ Tost (die anderen), in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013, 594–600, 595.
Bereits in einer Interview-Aufnahme vom 20. Januar 1987 äußern sich die beiden Gründungsmitglieder Olaf Tost und Stefan Schüler ebenfalls bezüglich der Namensgebung folgendermaßen:
„Wir wollen nicht anders sein […], wir machen auch nicht Musik gegen jemanden, wir heißen zwar die anderen, aber […] das ist kein Eigenname, man könnte zum Beispiel sich folgendes Plakat vorstellen: Heute spielen Hard Pop und die anderen, und nach Hard Pop wird alles klein geschrieben.“Olaf Tost, Stefan Schüler: Die anderen (Interview vom 20. Januar 1987), nachzuhören auf der von Lutz Schramm betriebenen Plattform Parocktikum (00:00): https://podcast.parocktikum.de/2006/10/29/die-anderen-interview-vom2011987 (25. 11. 2024).
Interessant erscheint hier insbesondere die Aussage, dass es sich um keinen Eigennahmen handelt, womit wiederum die aus dem Band-Kontext extrahierte Bezeichnung geradezu prädestiniert erscheint für die Verwendung als Szene-Überbegriff, welcher nun all die DDR-Bands erfassen soll, die vor allem jenseits der offiziellen Produktionsstrukturen bzw. realsozialistischen Klangvorstellungen agieren. Viral geht die Bezeichnung dann jedoch (durchaus widersprüchlich) mit der ersten AMIGA-Veröffentlichung die anderen Bands (Kleeblatt 23, 1988), für die ursprünglich auch die Band die anderen vorgesehen ist, welche sich dann aber aufgrund von inakzeptablen Zensurversuchen von der Produktion verabschiedet.„Wir haben eigentlich keine richtigen Repressionen erlebt, mehr die kleinkarierten Ärgernisse. Es sollte zum Beispiel beim Staatslabel Amiga einen Sampler mit neuen Bands geben: auf der einen Seite wir [die anderen] und Hard Pop und auf der anderen zwei Heavy Metal-Bands. Wir versuchten aber, statt der Metal-Bands noch weitere schräge, junge Gruppen unterzubringen. Aber daraufhin fing Amiga plötzlich damit an, an unseren Texten herumzumäkeln, obwohl die Songwahl bereits abgeschlossen war. Nachdem sie reichlich Änderungen und Kürzungen verlangt hatten, sind wir ausgestiegen.“ Olaf Tost in: Intellektuelle und Spaßrabauken. Interview mit Olaf „Toster“ Tost (die anderen), in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013, 594–600, 596. Somit sind die anderen selbst nicht auf dem Sampler vertreten.Die Band veröffentlicht erst auf dem zweiten AMIGA-Sampler „Parocktikum. die anderen bands“ (1989) den Song „Gelbe Worte“, mit den (gemäß der Interpretation d. Verf.) Stasi-bezogenen Textzeilen: „Und auf den Straßen geht ein Mann, der alles weiß und alles kann, schreibt gelbe Worte an die Tür und liegt am Abend neben Dir (oder mir).“ Es erscheint jedoch durchaus plausibel, dass genau auf diesem Wege zumindest der Name hängengeblieben ist, der dann ab 1988 von AMIGA gefeatured als Szene-Label weite Verbreitung findet und sich am Ende (nicht ohne Kritik) auch durchsetzt.Vgl. Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 429 f. Offensichtlich kann sich insbesondere das junge Publikum gut mit der Bezeichnung identifizieren, da diese doch auch dem Bedürfnis nach individueller Abgrenzung Ausdruck verleiht, wohingegen die ebenfalls kursierende Zuschreibung Die Neuen Bands (Artikelserie in der Zeitschrift Unterhaltungskunst) diesbezüglich zu neutral erscheint.
Trotz dieser ab 1986 zunehmenden produktionstechnischen Interaktion zwischen der Szene und den verschiedenen Staatsmedien (DT 64, AMIGA, Unterhaltungskunst) lässt sich jedoch auch an dieser Stelle im Grunde keine staatlich geplante Vereinnahmungsstrategie erkennen. Es zeigen sich vielmehr gehäuft diverse Zufälle am Werk, die von unterschiedlichen Seiten motiviert wiederum das komplexe und dynamisch-kreisläufige Wechselspiel der „relationalen Macht- und Kräfteverhältnisse“ (Foucault) veranschaulichen, welches schließlich auch das Werden und Wesen der Anderen Bands entscheidend prägt und diesem, den realsozialistischen Umständen entsprechend einzigartigen, kultur-politischen Gesamtkunstwerk eine über den gewöhnlichen Bandradius hinausreichende, zusätzliche Bedeutungsebene verleiht, die noch immer auf ganz besondere Weise trägt. Während „das andere“ (Wicke), wie unter Punkt II beschrieben, noch als ideeller, Musik-vermittelter Westimport die Mauer durchdringt und auch die Jugend im Osten erst am Radioapparat und später im Proberaum begeistert (Lieder machen Leute), so erscheint das Andere der Anderen Bands (auch da wo es internationale Musikentwicklungen reflektiert) in seinem Kern hausgemacht, wobei das künstlerisch Eigenständige hier immer auch aus der unvermeidlichen (z. T. notgedrungenen oder gar erzwungenen) Band-Staat-Relation resultiert, so dass diese Musik nun qualitativ wie kaum eine andere zeitgenössische Kunstform in ganz besonderem Maße die komplexen gesellschaftspolitischen Verhältnisse ihrer Raum-Zeit verkörpert bzw. vermittelt (Lieder machen Leute machen Lieder). Die Anderen Bands existieren nicht lediglich trotz der DDR (eine zu kurz greifende Vereinfachung), sondern mit oder gar durch diesen Staat, welcher hier (als Mit- oder Gegenspieler) einen ganz wesentlichen Teil der dynamischen Handlungsräume ausrichtet und sich so in die jeweiligen Produktionen einschreiben kann. Aus dieser Perspektive erscheint dann wiederum auch die Bezeichnung selbst durchaus passend, da sie aufgrund ihrer spezifischen Genese gerade auf diese komplexe und konfliktgeladene Beziehung verweist – ein Umstand, welcher allerdings ebenfalls die bestehende Kritik an der Bezeichnung bzw. deren Ablehnung begründet. Die gemeinsamen, letztlich identitätsstiftenden Grundzüge der ansonsten auf klanglich-ästhetischer Ebene zunächst eher zusammenhangslos wirkenden, äußerst heterogenen Szene der Anderen Bands – Selbstorganisation, Selbstermächtigung und Raumnahme – erfolgen auch bei zunehmender Distanzierung bis zum Schluss immer nur in der direkten oder indirekten Auseinandersetzung mit dem Staatsapparat, so dass der finale Kollaps des Systems 1990 schließlich auch das Ende vieler Bands bedeutet. Nur wer in der Lage ist, sich mit der politischen Wende neu zu positionieren, kann seinen musikalischen Weg erfolgreich fortsetzen.
IV. Musik, von der andere träumen
Ein erheblicher Teil der in der DDR produzierten und aufgeführten Pop-/Rockmusik (bis hin zur Heavy Metal-Szene der späten 1980er Jahre) ist stark an westlichen Vorgaben orientiert oder erfüllt gar eine konkrete, auf die jeweiligen Originale abgestimmte (bewusst inszenierte) Stellvertreterfunktion.Eine solche Cover-Kultur findet man auch heute vor allem in Gesellschaftsordnungen, die den Menschen nur wenig direkte Teilhabe am internationalen Musikgeschehen ermöglichen. Mit den Anderen Bands hingegen erscheinen künstlerisch eigenständige Stimmen, die sich in zunehmendem Maße Gehör verschaffen, dabei jedoch lediglich eine vergleichsweise eher überschaubare Anzahl an Zuhörern erreichen.„Am Anfang war der Traum, in einer großen Band mitzuspielen. Dann kam der Traum, eine Band zu machen, von der andere träumen.“ André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 2. Die breite Masse der Bevölkerung wünscht vor allem die Weststars zu hören, welche dann im Rahmen von FDJ-Großveranstaltungen kurz vor dem Mauerfall auch tatsächlich noch auf den Bühnen der Republik erstrahlen dürfen. Dabei kommt es zu denkwürdigen und zugleich seltsam anmutenden Momenten wie diesem: Tausende Ostdeutsche skandieren 1988 während dem Springsteen-Konzert unter den Augen und Ohren der Staatsmacht begeistert und aus vollen Kehlen Born in the USA. Dieses Szenario wiederum inspiriert Kai-Uwe Kohlschmidt von der Band Sandow zu Born in the G.D.R. – ein Song, der in ganz wenigen Zügen den Geist der Zeit erfasst, kritisch reflektiert und dabei lediglich mit einigen sparsamen Andeutungen (Katarina Witt, Kurt Hager) im Grunde die gesamte kulturpolitische Dimension vermittelt. Dementsprechend avanciert das Stück schnell zu einem der großen Szene-Hits der Wendezeit – ein auf allen Ebenen äußerst turbulenter Zeitraum, welcher für die Anderen Bands insgesamt eine Hochphase darstellt und gleichzeitig bereits das Ende der Szene bedeutet und die bevorstehende Diaspora einleitet. Die über Nacht in Kraft getretenen Marktkonditionen der auf Konkurrenz und Finanzkraft basierenden westlichen Musikindustrie (der neuen Über-Macht im Handlungsspielraum) machen es den meisten Bands unmöglich, sich entsprechend zu positionieren oder gar erfolgreich zu integrieren. Derweil holt das eigene Publikum (verständlicherweise) zunächst vor allem die musikalischen Abenteuer nach, die ihm bisher verwehrt geblieben sind. Somit verschwinden viele Bands (und mit ihnen ein gesamter popkultureller Kosmos) zum Teil beinahe unbemerkt im Getöse der Umbrüche. In einem ersten Rückblick schreibt Marco Fiebag 15 Jahre danach:
„Leider haben nur ganz wenige Bands von damals diese Veränderungen überstanden oder zumindest eine gewisse Zeit noch durchgehalten. Die vielfältig einströmenden neuen Einflüsse, die harte Marktrealität oder, vereinfacht gesagt, die neuen Verhältnisse waren nicht gerade förderlich, mit Altbewährtem einfach fortzufahren. […] Für Big Savod oder den Expander des Fortschritts war da wenig Platz, wenn auch die Konzerte noch gut besucht waren. Nach und nach verschwanden die sogenannten anderen Bands aus dem Blickfeld der Medien und Fans.“Marco Fiebag: die anderen bands. 15 Jahre danach, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013, 697–712, 697.
Mit dem Ausfall der bis dato geltenden (relationalen) Produktionskonditionen, welche insbesondere hinsichtlich der Anderen Bands auf zum Teil sehr subtile Art im sich nun auflösenden gesellschaftspolitischen Koordinatensystem der DDR angelegt sind, verliert sich auch der jeweils zeitbezogene Sinnzusammenhang, so dass es vielen Musikern im neuen System dementsprechend sinnlos erscheinen muss, ihre Kunst weiterzuführen wie bisher. Die hiermit sowohl auf existenzieller als auch auf künstlerischer Ebene einsetzende Neuorientierung lässt dann allerdings zahlreiche Akteure tatsächlich weit über das „Altbewährte“ hinauswachsen und im Verlaufe der 1990er Jahre in ganz unterschiedlichen Konstellationen oder Formationen erneut Erfolge feiern. So gilt beispielsweise Frank Bretschneider (AG Geige, 1986–1993) heute auf dem Gebiet der experimentellen elektroakustischen Musik als bedeutender und international renommierter Komponist, Performer und Label-Betreiber. Die Brüder Ronald (bis 1983 Schlagzeuger bei Rosa Extra) und Robert Lippok (beide Ornament & Verbrechen, 1983–1994) beschreiten mit der 1995 gegründeten Post-Rockband To Rokoko Rot (bis 2015) neue Wege. Doch die eindrucksvollste Erfolgsgeschichte schreiben bekanntlich die einstigen Bandmitglieder von Feeling B (1983–1993/2000), Paul Landers, Christian „Flake“ Lorenz und der später hinzugekommene Schlagzeuger Christoph Schneider (bezeichnenderweise ohne Aljoscha Rompe, der Feeling B noch bis zu seinem Tod im Jahr 2000 zumindest phasenweise am Leben hält), die 1994 mit der Band Rammstein eine der kommerziell erfolgreichsten Rockbands des Planeten starten und seither sowohl auf musikalischer als auch auf medialer Ebene die oben beschriebene Ausweitung der Kampfzone im neuen System mit anderen (angemesseneren) Mitteln fortsetzen (wenn auch heute sicherlich etwas weniger un-ordentlich, verglichen mit den damaligen Guerilla-Taktiken von Feeling B).
Andere wiederum verbleiben im (erweiterten) Rahmen ihrer bereits im DDR-Kontext formulierten Band-Identitäten, allerdings ebenfalls nicht ohne künstlerische Weiterentwicklung(en). Allen voran André Greiner-Pol (aktiv seit 1977), der mit seiner überwiegend neu besetzten Band Freygang (am Bass nun mit Tatjana Besson, früher Die Firma) auf der Grundlage einer soliden Fangemeinde vor allem im Osten der Republik bis zu seinem Lebensende 2008 seine eigene Version von deutschsprachigem Bluesrock auslebt – „[…] ein bisschen abheben, ungefähr so 2 cm von der Erde“André Greiner-Pol, MDR/artour: Bericht zum Tod von André Greiner-Pol, (00:00), https://www.youtube.com/watch?v=JL5qA6Cd750 (20. 11. 2024).. Weitere Bands wie beispielsweise Die Art (1985 aus Die Zucht hervorgegangen) oder auch Sandow (aktiv seit 1982) bewegen sich im Laufe der 1990er Jahre zum Teil sehr experimentierfreudig zwischen verschiedenen ästhetischen Formaten – eine Reise, an deren Ende dann allerdings zunächst die Auflösung steht (Sandow 1999, Die Art 2001), nach welcher sich jedoch beide Bands wieder zusammenfinden und seither aktiv Präsenz zeigen (augenzwinkernd haben sie den jüngeren Bands schließlich mindestens eine Besonderheit voraus – „niemand kann mehr eine DDR-Band werden“Kai-Uwe Kohlschmidt im Gespräch mit Andreas Müller vom 30. November 2022 (04:50), 40 Jahre Punkband Sandow, Deutschlandfunk Kultur: https://www.deutschlandfunkkultur.de/sandow-band-album-ddr-100.html (25. 11. 2024).). So veröffentlicht Die Art zuletzt 2023 das Album Fading und Sandow 2022 das Doppelalbum Kinder des Verbrechens (zum 40-jährigen Bestehen der Band). Das hier zu beobachtende Phänomen der Re-Union, oftmals in Verbindung mit der Veröffentlichung bzw. Wiederveröffentlichung von älteren, vor allem aus den 1980er Jahren stammenden Aufnahmen (zuletzt Extrakte 1980–1984 von Rosa Extra, 2023) erscheint nun wiederum kennzeichnend für die Gesamtentwicklung der Szene in den vergangenen drei Jahrzehnten nach der Wende (technisch gestützt durch die parallel verlaufende Digitalisierung und zunehmende Demokratisierung der Produktions- und Distributionsmittel), was jedoch bereits angesichts der mittlerweile kaum mehr zu überblickenden Materialfülle an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden kann.
Diese unverminderte Aktivität – unter anderem das Resultat eines lange gewachsenen Sendungsbewusstseins – zeugt einmal mehr von der besonderen Flexibilität der (einstigen) Szene (nun im neuen Handlungsraum BRD) und zudem vor allem von einem anhaltenden Publikumsinteresse, welches wiederum begleitet (möglicherweise gar angeregt) wird, durch eine mittlerweile äußerst umfangreiche, journalistisch oder akademisch motivierte Fachliteratur.Hinzu kommen zahlreiche Tagungen oder Lehrveranstaltungen wie beispielsweise das Seminar „Musik Macht Gesellschaft: Die Anderen Bands der DDR aus künstlerischer und kulturpolitischer Perspektive (zwischen Einstufung und Ausstieg)“, Steffen Scholl, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Humboldt Universität zu Berlin, Sommersemester 2023. Insbesondere seit der Jahrtausendwende nimmt die Anzahl der Publikationen beständig zu, wobei Zeitzeugenberichte, Experteninterviews oder Archivrecherchen zum Tragen kommen, welche zusammengenommen ein sehr lebendiges, detailliertes und gleichzeitig umfassendes Bild der Anderen Bands vermitteln. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand in den bereits angeführten Arbeiten von Peter Wicke, Michael Rauhut, Ronald Galenza oder Florian Lipp erfolgt dabei zumeist integrativ im kulturpolitischen Kontext von Rockmusik, Blues, Punk oder New Wave, welcher sich durch Literatur zu verwandten Themenbereichen wie TanzmusikVgl. Simon Bretschneider: Tanzmusik in der DDR. Dresdner Musiker zwischen Kulturpolitik und internationalem Musikmarkt, 1945–1961, Bielefeld 2018 (= Musik und Klangkultur 31)., Heavy MetalVgl. Wolf-Georg Zaddach: Heavy Metal in der DDR. Szene, Akteure, Praktiken, Bielefeld 2018 (= texte zur populären Musik 10); oder Nikolai Okunew: Red Metal. Die Heavy-Metal-Subkultur der DDR, 2., durchgesehene Auflage, Berlin 2021. oder GothicVgl. Sascha Lange, Dennis Burmeister: Our Darkness. Gruftis und Waver in der DDR, Mainz 2022. in der DDR systematisch erweitern lässt.Zur alternativen (anderen) Neuen (E-)Musik in der DDR vgl. u. a. Frank Schneider: Momentaufnahme. Notate zu Musik und Musikern in der DDR, Leipzig 1979 (= Reclams Universal-Bibliothek 785); oder Michael Berg, Albrecht von Massow, Nina Noeske (Hg.): Zwischen Macht und Freiheit. Neue Musik in der DDR, Köln, Weimar, Wien 2004 (= KlangZeiten 1); oder Nina Noeske: Musikalische Dekonstruktion. Neue Instrumentalmusik in der DDR, Köln, Weimar, Wien 2007 (= KlangZeiten 3). Eine über die Musik hinausreichende Möglichkeit zur Vertiefung insbesondere der politischen Dimension bietet beispielsweise die Publikation Staatsauftrag: Kultur für alle, Ziele, Programm und Wirkungen kultureller Teilhabe und Kulturvermittlung in der DDR von Birgit Mandel und Birgit Wolf (Bielefeld 2020). Auch die u. a. von Dirk OschmannDirk Oschmann: Der Osten: eine westdeutsche Erfindung, Berlin 2023. oder Steffen MauSteffen Mau: Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Berlin 2019; oder ders.: Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt, Berlin 2024 (= edition suhrkamp Sonderdruck). geführte (soziologische) Debatte um die prozesshafte Konstitution einer ostdeutschen Identität erscheint im Zusammenhang mit der alternativen Musikszene der DDR bzw. deren Fortsetzung in der BRD von großer Bedeutung: Die aus dem beständigen Wechselspiel der dynamischen Macht- und Kräfteverhältnisse resultierende kulturelle Identität (wie oben dargestellt, sowohl auf kollektiver als auch auf individueller Ebene), lässt sich nicht lediglich durch Einzelperspektiven erschließen oder gar final fixieren, sondern muss gemäß ihrer Entwicklungsprozesse aus verschiedenen Blickwinkeln erfasst und ihrer Komplexität entsprechend auf die jeweiligen Begleitumstände zurückgeführt werden. Nur so lässt sich ein adäquater, wenn auch unabgeschlossener Eindruck vermitteln – „Denn Ich ist ein anderer. Wenn das Kupfer als Trompete erwacht, so ist es nicht seine Schuld.“Arthur Rimbaud: „Seher-Brief“ an Paul Demeny vom 15. Mai 1871, in: ders.: Sämtliche Dichtungen. Zweisprachige Ausgabe, aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und einem Nachwort hg. von Thomas Eichhorn, München 1997, 368–379, 371.
Literatur
Michael Rauhut: Beat in der Grauzone. DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, Berlin 1993 (= BasisDruck Dokument 16)
Peter Wicke, Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7)
André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000
Ronald Galenza, Heinz Havemeister (Hg.): Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010
Ronald Galenza, Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013
Michael Rauhut, Thomas Kochan (Hg.): Bye bye, Lübben City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2018
Wolf-Georg Zaddach: Heavy Metal in der DDR. Szene, Akteure, Praktiken, Bielefeld 2018 (= texte zur populären Musik 10)
Nikolai Okunew: Red Metal. Die Heavy-Metal-Subkultur der DDR, 2., durchgesehene Auflage, Berlin 2021
Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4)
Sascha Lange, Dennis Burmeister: Our Darkness. Gruftis und Waver in der DDR, Mainz 2022
Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023
Anmerkungen
- Insbesondere der „Rauch-Haus-Song“ vom zweiten Scherben-Album „Keine Macht für Niemand“ (1972) thematisiert die Hausbesetzung im Dezember 1971 bzw. die Polizeirazzia im April 1972 unter Bezugnahme auf den zuvor erschossenen Georg von Rauch. Die aus West-Berlin stammende Band Ton Steine Scherben stellt außerdem einen bedeutenden musikalischen und textlichen Einfluss auch auf die Anderen Bands der DDR dar, welcher sich beispielsweise im Programm der Ost-Berliner Band Freygang in Form von Cover-Songs wie beispielsweise „Ich will nicht werden, was mein Alter ist“ (Ton Steine Scherben, 1971) niederschlägt. Vgl. André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 283–285.
- Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I, Frankfurt a. M. 2019, 95.
- Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I, Frankfurt a. M. 2019, 93.
- Zur soziologisch geprägten Begrifflichkeit des relationalen Handlungsraums bzw. zur Entstehung von Raum in der Wechselwirkung zwischen Handeln und Strukturen vgl. Martina Löw: Raumsoziologie, Frankfurt a. M. 2001, 152 ff.
- Auf die kontextuelle Bedeutung der hier relevanten Bands und die tatsächliche Komplexität der gesellschaftlichen Gesamtsituation bzw. auf die unzureichende Annahme einer lediglich bipolaren Zweidimensionalität der Kräfteverhältnisse verweist bereits einer der frühesten Texte zu dieser Thematik: „Für beide Seiten, die sicherlich nicht mit dem simplen Konstrukt ‚Musiker und Publikum hier – Institutionen da‘ gleichzusetzen sind, gibt es ernstzunehmende Argumente. Doch so vielschichtig sich die Problematik auch darstellt, unsere Gesellschaft kommt um eine Bewertung nicht herum. Wir sind nun aufgefordert, unsere Meinung zum Thema ‚Alternativrock‘ zu Papier zu bringen […].“ Uwe Baumgartner, Susanne Binas, Peter Zocher: „Alternativrock“ in der DDR?, Leipzig 1989 (Forschungszentrum Populäre Musik, HU-Berlin, FPM-Publikation 27, 1989), 1, online unter https://www.musikundmedien.hu-berlin.de/de/musikwissenschaft/pop/forschungszentrum-populaere-musik/baumgartner-uwe-binas-susanne-zocher-peter-1989-alternativrock-in-der-ddr.pdf (30. 11. 2024).
- Zur Unterscheidung von power to/power over innerhalb des Machtbegriffs vgl. Boris Voigt: Memoria, Macht, Musik, Eine politische Ökonomie der Musik in vormodernen Gesellschaften, Kassel u. a. 2008, 19 f.
- Zum Verhältnis von Macht und Freiheit bei Michel Foucault vgl. Byung-Chul Han: Was ist Macht?, Stuttgart 2005 (= Universal-Bibliothek 18356), 124 ff.
- Peter Wicke: Zwischen Förderung und Reglementierung – Rockmusik im System der DDR-Kulturbürokratie, in: ders., Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 11–27, 11 f.
- Zu diesen frühen Aufbrüchen vgl. Michael Rauhut: Beat in der Grauzone. DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, Berlin 1993 (= BasisDruck Dokument 16).
- Peter Wicke: Zwischen Förderung und Reglementierung – Rockmusik im System der DDR-Kulturbürokratie, in: ders., Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 11–27, 17.
- Die in diesem Zusammenhang häufig angeführte staatliche Vorgabe (umgesetzt von der Anstalt zur Wahrung der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte auf dem Gebiet der Musik, AWA) – bekannt als 60/40-Regel, die besagt, dass im öffentlichen Kontext mindestens 60 % der gespielten Musik aus der DDR bzw. dem Ostblock kommen soll, erscheint hinsichtlich der Anderen Bands weniger von Bedeutung, da deren Programme größtenteils aus Eigenkompositionen bestehen und die Forderung somit gar zu 100 % erfüllen.
- Zum Einstufungssystem vgl. Michael Rauhut: Beat in der Grauzone. DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, Berlin 1993 (= BasisDruck Dokument 16), 42 ff.
- Vgl. Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 392–414.
- Zur Konzeption der Zersetzungsmaßnahmen durch die Staatssicherheit: „Offiziell eingeführt wurde es im Januar 1976 mit der Richtlinie Nr. I/76 über die Entwicklung und Bearbeitung Operativer Vorgänge und beinhaltete ‚leise‘ (d. h. psychologische) Methoden, um Personen gezielt zu beeinträchtigen und zu schädigen, mit dem Ziel, dass sie daraufhin ihre Aktivitäten oder ihren Widerstand aufgaben.“ Katja Hoyer: Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990, Hamburg 2023, 372.
- Katja Hoyer: Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990, Hamburg 2023, 282 f.
- Vgl. „Anderson“, ein Film von Annekatrin Hendel (mit Sascha Anderson u. a.), 2014.
- Wolf Biermann: Der gräßliche Fatalismus der Geschichte, Dankrede zur Büchnerpreisverleihung 1991, https://www.deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/georg-buechner-preis/wolf-biermann/dankrede (30. 11. 2024).
- [Michael Rauhut, André Greiner-Pol]: Simultanschach. André Greiner Pol über Stasi-Verstrickungen, in: André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 47–52, 48.
- Michael Rauhut: Auf Entzug. Die Akte „Benjamin Karo“, in: André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 40–46, 44.
- Michael Rauhut: Auf Entzug. Die Akte „Benjamin Karo“, in: André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 40–46, 46.
- Peter Wicke: Zwischen Förderung und Reglementierung – Rockmusik im System der DDR-Kulturbürokratie, in: ders., Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 11–27, 17.
- Platon: Der Staat, eingeleitet, übersetzt und erklärt von Karl Vretska, Stuttgart 2015 (= Universal-Bibliothek 8205), 184 (402a).
- Platon: Der Staat, eingeleitet, übersetzt und erklärt von Karl Vretska, Stuttgart 2015 (= Universal-Bibliothek 8205), 183 (401d–e).
- Platon: Der Staat, eingeleitet, übersetzt und erklärt von Karl Vretska, Stuttgart 2015 (= Universal-Bibliothek 8205), 211 (424c).
- Bodo Mrozek: Jugend Pop Kultur. Eine transnationale Geschichte, Berlin 2019 (= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 2237), 124.
- Zu diesen frühen Aufbrüchen vgl. Michael Rauhut: Beat in der Grauzone. DDR-Rock 1964 bis 1972 – Politik und Alltag, Berlin 1993 (= BasisDruck Dokument 16), 49 ff.
- Margot Honecker, zit. n. Katja Hoyer: Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990, Hamburg 2023, 272.
- Katja Hoyer: Diesseits der Mauer. Eine neue Geschichte der DDR 1949–1990, Hamburg 2023, 271.
- Michael Rauhut: Rock in der DDR 1964 bis 1989, Bonn 2002 (= ZeitBilder), 36.
- Als sehr eindrucksvolles Zeitdokument gilt diesbezüglich der Film „Seitenwechsel“ (1977) von Olaf Leitner (mit Klaus Jentzsch, nach dessen Ausreise in die BRD/West-Berlin 1976), der als westdeutscher Musikjournalist auch eines der ersten Bücher über den DDRock (Leitner) verfasst: Rockszene DDR. Aspekte einer Massenkultur im Sozialismus, Reinbek bei Hamburg 1983 (= rororo 7646).
- Mit den beiden Bitterfelder Konferenzen 1959 und 1964 wird der Versuch unternommen, eine eigene, sozialistische Kulturpolitik auf den sogenannten Bitterfelder Weg zu bringen.
- Zur vergleichbaren Konzeption des Sozialistischen Realismus in der Musik, vgl. Walther Siegmund-Schultze: Theorie und Methode des sozialistischen Realismus in der Musik, in: Siegfried Bimberg, Werner Kaden, Eberhard Lippold, Klaus Mehner, Walther Siegmund-Schultze (Hg.): Handbuch der Musikästhetik, 2. Auflage, Leipzig 1986, 149–183.
- Vgl. David Tompkins: Musik zur Schaffung des neuen sozialistischen Menschen: Offizielle Musikpolitik des Zentralkommitees [sic] der SED in der DDR in den 50er Jahren, in: Tillmann Bendikowski, Sabine Gillmann, Christian Jansen, Markus Leniger, Dirk Pöppmann (Hg.): Die Macht der Töne. Musik als Mittel politischer Identitätsstiftung im 20. Jahrhundert, Münster 2003, 105–113.
- „Lieder machen Leute“, Regie: Gitta Nickel, DEFA-Studio für Dokumentarfilme 1968 (erschienen auf DVD in der Reihe Die DDR in Originalaufnahmen, Singeklubs in der DDR).
- Zur Vereinnahmung und Instrumentalisierung von Singebewegung und Oktoberklub durch verschiedene Instanzen der Kulturpolitik, siehe Bettina Wegner (Gründungsmitglied des Hootenanny-Klubs und spätere Liedermacherin) im Film „Bettina“ von Lutz Pehnert, 2022 (DVD/2023).
- Eine kritische Darstellung dieser Ereignisse findet sich in der Autobiographie von Wolf Biermann. Siehe ders.: Warte nicht auf bessre Zeiten! Die Autobiographie, Berlin 2016, 275 ff.
- Die auch von staatlicher Seite gewünschte oder gar verordnete Verwendung der deutschen Sprache soll zunächst dazu dienen, den Einflussbereich der englischsprachigen Klassenfeinde auf musikalischer Ebene einzuschränken. Tatsächlich erweist sich der beinahe flächendeckende Gebrauch des Deutschen in der Rockmusik der DDR jedoch bereits in den 1970er Jahren (und später ebenso hinsichtlich der Anderen Bands) als besonders geeignete Ausdrucksform zur möglichen Kommunikation auch von gesellschaftlichen bzw. systemkritischen Tabuthemen – man versteht es, vor allem im Rahmen der Muttersprache auch zwischen den Zeilen zu texten bzw. zu lesen.
- Peter Wicke: Anatomie des Rock, Leipzig 1987, 177.
- Textbeginn des Songs „Das Kartenhaus“ der Band Freygang (E. Kenner/A. Greiner-Pol) von 1990, vgl. Freygang XXX Songs 1977–2007, Berlin 2007, 34.
- Mit Blick auf diese Form der kulturpolitischen Wechselwirkung heißt es in der „Populärballade“ von Wolf Biermann: „Ihr löscht das Feuer mit Benzin, Ihr löscht den Brand nicht mehr, Ihr macht was Ihr verhindern wollt: Ihr macht mich populär.“ Ders.: Warte nicht auf bessre Zeiten! Die Autobiographie, Berlin 2016, 180.
- Vgl. Die Freygang-Biographie/Freygang Katalog, in: André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 303–309.
- Susanne Binas: Die „anderen Bands“ und ihre Kassettenproduktionen – Zwischen organisiertem Kulturbetrieb und selbstorganisierten Kulturformen, in: Peter Wicke, Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 48–60, 48.
- „Viele der spät oder gar nicht bei Amiga zu einer Veröffentlichung gekommenen Bands hatten ihre eigenen Home-Labels: Die Art hatte Hartmut Productions in Leipzig, AG Geige seit 1985 KlangFarbe, die Dresdner Band Kaltfront seit 1987 die ZIEH-DICH-WARM-AN-TAPES, das Freie Orchester aus Berlin seit 1986 die Krötenkassetten.“ Susanne Binas: Die „anderen Bands“ und ihre Kassettenproduktionen – Zwischen organisiertem Kulturbetrieb und selbstorganisierten Kulturformen, in: Peter Wicke, Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 48–60, 56.
- Dementsprechend zirkuliert auch in jüngeren Publikationen die Bezeichnung Magnetbanduntergrund. Vgl. Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023.
- In diesem Sinne beantwortet auch Michael Rauhut die Frage „Brachte Rockmusik die Mauer ins Wanken?“ durchaus positiv: „Statt das System zu stabilisieren, diente Rockmusik vielfach als ein emanzipatorisches Medium, durch das Widerstand und Wandel erlebbar wurden. Im kulturellen Gebrauch dieser Musik etablieren sich alternative Sozialisations- und Kommunikationsmuster, die dem staatlichen Erziehungsanspruch zuwiderliefen.“ Ders.: Raus aus der Spur. Brachte Rockmusik die Mauer ins Wanken?, in: Dominik Schrage, Holger Schwetter, Anne-Kathrin Hoklas (Hg.): „Zeiten des Aufbruchs“ – Populäre Musik als Medium gesellschaftlichen Wandels, Wiesbaden 2019 (= Auditive Vergesellschaftungen Hörsinn – Audiotechnik – Musikerleben), 183–202, 198.
- Ronald Galenza: Was mir deine Schleuder ist dir meine Waschmaschine. Von Rosa Extra zu Hard Pop, in: Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023, 67–91, 70. In die alternative Literaturszene hinein spielt Rosa Extra/Hard Pop auch mit musikalischen Beiträgen zur Lyrik-Publikation „Ich fühle mich in Grenzen wohl“ (1986) von Bert Papenfuß-Gorek, Stefan Döring, Sascha Anderson und Jan Faktor.
- Vergleichbar mit der Umbenennung der Band Die Zucht in Die Art im Rahmen ihres offiziellen Einstufungsverfahrens 1985.
- Ronald Galenza: Was mir deine Schleuder ist dir meine Waschmaschine. Von Rosa Extra zu Hard Pop, in: Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023, 67–91, 88.
- Susanne Binas: Die „anderen Bands“ und ihre Kassettenproduktionen – Zwischen organisiertem Kulturbetrieb und selbstorganisierten Kulturformen, in: Peter Wicke, Lothar Müller (Hg.): Rockmusik und Politik. Analysen, Interviews und Dokumente, Berlin 1996 (= Forschungen zur DDR-Geschichte 7), 48–60, 48.
- Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 155.
- Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 153.
- Theodor W. Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt a. M. 1980 (= Gesammelte Schriften 4), Nr. 18 „Asyl für Obdachlose“, 42 f., 43.
- Zur Relativierung der Aussage durch Adorno selbst, siehe Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 48.
- Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 48.
- Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 154.
- Wilhelm Schmid: Philosophie der Lebenskunst. Eine Grundlegung, Frankfurt a. M. 1998, 154.
- Die hier angeführten Titel erscheinen noch im Januar 1990 auf einer der ersten Punk-Langspielplatten der DDR („Hea Hoa Hoa Hea Hea Hoa“) via AMIGA.
- Zu Aljoscha Rompe (1947–2000) bleibt anzumerken, dass der umtriebige Organisator und Strippenzieher gesellschaftlich eine extreme Sonderstellung einnimmt: Aufgewachsen als wohlbehütetes Kind der Elite in Ost-Berlin entdeckt Rompe aufgrund einer Erbschaftsangelegenheit, dass sein gerader verstorbener (bis dahin unbekannter) leiblicher Vater Schweizer Staatsbürger war und er demnach ein Anrecht auf einen Schweizer Pass hat, den er 1978 auch bekommt, die DDR daraufhin aber nicht verlässt, sondern schnell enttäuscht vom Westen forthin eine Ausnahme-Existenz im Osten führt.
- Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Geh zurück in dein Buch. Vorwort, in: dies.: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 10–17, 13 f.
- Peter Wicke: „Populäre Musik“ als theoretisches Konzept, in: PopScriptum 1/92, 21.
- Vgl. Michael Rauhut, Thomas Kochan (Hg.): Bye bye, Lübben City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2018.
- Siehe auch 1000-Jahrfeier, Altenburg 1976, oder Pressefest, Erfurt 1978, vgl. Jan Schönfelder: Gitarren und Knarren, Krawall auf dem Erfurter Pressefest 1978, in: Michael Rauhut, Thomas Kochan (Hg.): Bye bye, Lübben City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2018, 225–240.
- Vgl. Daniel Weißbrodt: Karneval in Wasungen. Das Volksfest als subkulturelles Happening, in: Michael Rauhut, Thomas Kochan (Hg.): Bye bye, Lübben City. Bluesfreaks, Tramps und Hippies in der DDR, erweiterte Neuausgabe, Berlin 2018, 306–320.
- Vgl. Ronald Galenza: Lugau – Wie Punk aufs Dorf kam, in: ders., Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013, 348–353.
- Vgl. Karen Kolbe-Döhring, Frank Döhring (Hg.): Freiheit, Blues und Scherben. Geschichten eines Musikfestivals, Dresden 2021.
- Uwe Hager im Kapitel: Alles ist so dufte. Steinbrücken, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 175–183, 175.
- Lutz Schramm: X-Mal! Musik zur Zeit, Parocktikum Wiki: https://paroktikum.de/wiki/index.php?title=X-Mal!_Musik_zur_Zeit (23. 10. 2024).
- „Insgesamt ist der Raum ein Ort, mit dem man etwas macht.“ Michel de Certeau: Kunst des Handelns, Berlin 1988, 218.
- Michel de Certeau: Kunst des Handelns, Berlin 1988, 59.
- Byung-Chul Han: Was ist Macht?, Stuttgart 2005 (= Universal-Bibliothek 18356), 15.
- Vgl. Der Politbürobeschluss von 1988 und seine Folgen, in: Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 414–453.
- Vgl. Joachim Hentschel: Dann sind wir Helden. Wie mit Popmusik über die Mauer hinweg deutsche Politik gemacht wurde, Hamburg 2022.
- Vom 18. bis 25. Januar 1990 sind Musiker (Feeling B, Die Firma, Die Art, AG Geige, Sandow) und Künstler der alternativen DDR-Szene „als Kultur-Botschafter in der Kunst-Metropole Paris zu Gast. Der DDR-Kunstwissenschaftler Christoph Tannert war der Zaubermeister, er hatte den französischen Kulturminister Jack Lang mit dem Charme und der Exotik des ostdeutschen Kultur-Untergrundes verhext.“ Ronald Galenza und Heinz Havemeister im Kapitel: Eure Zukunft, die wird euch jagen. Paris, in: dies.: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 272–281, 272.
- Zum West-Berlin-Konzert von Feeling B und die anderen 9. November 1989 (im Kreuzberger Pike) vgl. im Kapitel: Ich such die DDR. Die Wende, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 242–271, 242–244.
- Als ein Teil des VEB Deutsche Schallplatten Berlin verantwortlich für die Veröffentlichung von zeitgenössischer Unterhaltungsmusik (Rock, Pop, Schlager, Jazz, Blues etc.).
- Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 485.
- Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 484.
- Neben dem VEB Deutsche Schallplatten Berlin, gilt der Rundfunk der DDR als bedeutender Musikproduzent in der DDR (verstärkt durch die Zunahme von privaten Homerecording-Studios in den 1980er Jahren als dritte Produktionskraft, allerdings von eher ungeklärtem Rechtsstatus).
- Vgl. Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 378–380.
- Siehe Neuveröffentlichung (2023) der unveränderten Original-LP durch SECHZEHNZEHN Musikproduktion (über Buschfunk erhältlich).
- Insgesamt eine Testreihe vor allem für jüngere Bands, denen die Plattenfirma noch keine umfangreichere LP-Produktion zutraut.
- Siehe Neuveröffentlichung (2023) der unveränderten Original-LP durch SECHZEHNZEHN Musikproduktion (über Buschfunk erhältlich).
- Eine andere, über die Grenzen der DDR hinausführende Geschichte, die an dieser Stelle jedoch nicht ausgeführt werden kann, erzählen die in der Bundesrepublik bzw. in West-Berlin erfolgten Materialveröffentlichungen wie beispielsweise auf der Split-LP „DDR von unten/eNDe“ (Aggressive Rockproduktionen, 1983) mit den beiden Bands Zwitschermaschine und Schleim-Keim (unter dem Pseudonym Sau-Kerle), nachzulesen u. a. in folgender Publikation: Kein Ende mit „eNDe“. Zur Geschichte von „DDR von Unten“. In den Worten von Dimitri Hegemann und Karl-Ulrich Walterbach, sowie des MfS, gesammelt und arrangiert von Alexander Pehlemann, in: Alexander Pehlemann, Ronald Galenza, Robert Mießner (Hg.): Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990, Berlin 2023, 93–106.
- Eine detaillierte Schilderung der für damalige Verhältnisse sehr ungewöhnlichen Produktionsumstände findet sich im Kapitel: Lass dir nicht erzählen, was du zu lassen hast. Amiga & Westtouren, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 224–241. Siehe auch die Neuveröffentlichung (2023) der unveränderten Original-LP (im Doppelpack mit dem zweiten Feeling B-Album „Wir kriegen euch alle“ von 1991) durch SECHZEHNZEHN Musikproduktion (über Buschfunk erhältlich).
- Vgl. Lutz Schramm: Die neuen Bands, Parocktikum Wiki: https://paroktikum.de/wiki/index.php?title=Die_neuen_Bands (29. 10. 2024).
- Vgl. u. a. das Kapitel: flüstern & SCHREIEN. Ein Rockreport, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 184–199.
- Jochen Wisotzki im Kapitel: flüstern & SCHREIEN. Ein Rockreport, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister: Mix mir einen Drink. Feeling B. Punk im Osten. Ausführliche Gespräche mit Flake, Paul Landers und vielen anderen, Berlin 2010, 184–199, 189.
- Der Film ist als DVD erhältlich oder in der Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung einsehbar: https://www.bpb.de/mediathek/video/264590/fluestern-und-schreien/ (3. 11. 2024).
- „Viele standen in einem inneren Zwiespalt zwischen dem ersehnten Zugriff auf Auftritts- und Produktionsmöglichkeiten und der damit verbundenen Gefahr, die tödliche Umarmung von Seiten des Kulturapparats zu erleiden, wie Kohlschmidt von Sandow es rückblickend im Interview formulierte.“ Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 430.
- Zur Kritik und dem damit einhergehenden „Käuflichkeitsvorwurf“ vgl. Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 442–446.
- Auch der Titel des Films „Das Leben der Anderen“ von Florian Henkel von Donnersmarck (2006) vermittelt dieses Motiv hinsichtlich der Konfliktsituation zwischen Staatsmacht, Staatssicherheit und Bevölkerung (hier mit speziellem Fokus auf Theatermachern und Literaten).
- Olaf Tost in: Intellektuelle und Spaßrabauken. Interview mit Olaf „Toster“ Tost (die anderen), in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013, 594–600, 595.
- Olaf Tost, Stefan Schüler: Die anderen (Interview vom 20. Januar 1987), nachzuhören auf der von Lutz Schramm betriebenen Plattform Parocktikum (00:00): https://podcast.parocktikum.de/2006/10/29/die-anderen-interview-vom2011987 (25. 11. 2024).
- „Wir haben eigentlich keine richtigen Repressionen erlebt, mehr die kleinkarierten Ärgernisse. Es sollte zum Beispiel beim Staatslabel Amiga einen Sampler mit neuen Bands geben: auf der einen Seite wir [die anderen] und Hard Pop und auf der anderen zwei Heavy Metal-Bands. Wir versuchten aber, statt der Metal-Bands noch weitere schräge, junge Gruppen unterzubringen. Aber daraufhin fing Amiga plötzlich damit an, an unseren Texten herumzumäkeln, obwohl die Songwahl bereits abgeschlossen war. Nachdem sie reichlich Änderungen und Kürzungen verlangt hatten, sind wir ausgestiegen.“ Olaf Tost in: Intellektuelle und Spaßrabauken. Interview mit Olaf „Toster“ Tost (die anderen), in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013, 594–600, 596.
- Die Band veröffentlicht erst auf dem zweiten AMIGA-Sampler „Parocktikum. die anderen bands“ (1989) den Song „Gelbe Worte“, mit den (gemäß der Interpretation d. Verf.) Stasi-bezogenen Textzeilen: „Und auf den Straßen geht ein Mann, der alles weiß und alles kann, schreibt gelbe Worte an die Tür und liegt am Abend neben Dir (oder mir).“
- Vgl. Florian Lipp: Punk und New Wave im letzten Jahrzehnt der DDR. Akteure – Konfliktfelder – musikalische Praxis, Münster und New York 2021 (= Musik und Diktatur 4), 429 f.
- Eine solche Cover-Kultur findet man auch heute vor allem in Gesellschaftsordnungen, die den Menschen nur wenig direkte Teilhabe am internationalen Musikgeschehen ermöglichen.
- „Am Anfang war der Traum, in einer großen Band mitzuspielen. Dann kam der Traum, eine Band zu machen, von der andere träumen.“ André Greiner-Pol: Peitsche Osten Liebe. Das Freygang-Buch, hg. von Michael Rauhut, Berlin 2000, 2.
- Marco Fiebag: die anderen bands. 15 Jahre danach, in: Ronald Galenza, Heinz Havemeister (Hg.): Wir wollen immer artig sein … Punk, New Wave, HipHop und Independent-Szene in der DDR 1980–1990, überarbeitete und erweiterte Neuausgabe, 4. Auflage, Berlin 2013, 697–712, 697.
- André Greiner-Pol, MDR/artour: Bericht zum Tod von André Greiner-Pol, (00:00), https://www.youtube.com/watch?v=JL5qA6Cd750 (20. 11. 2024).
- Kai-Uwe Kohlschmidt im Gespräch mit Andreas Müller vom 30. November 2022 (04:50), 40 Jahre Punkband Sandow, Deutschlandfunk Kultur: https://www.deutschlandfunkkultur.de/sandow-band-album-ddr-100.html (25. 11. 2024).
- Hinzu kommen zahlreiche Tagungen oder Lehrveranstaltungen wie beispielsweise das Seminar „Musik Macht Gesellschaft: Die Anderen Bands der DDR aus künstlerischer und kulturpolitischer Perspektive (zwischen Einstufung und Ausstieg)“, Steffen Scholl, Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft, Humboldt Universität zu Berlin, Sommersemester 2023.
- Vgl. Simon Bretschneider: Tanzmusik in der DDR. Dresdner Musiker zwischen Kulturpolitik und internationalem Musikmarkt, 1945–1961, Bielefeld 2018 (= Musik und Klangkultur 31).
- Vgl. Wolf-Georg Zaddach: Heavy Metal in der DDR. Szene, Akteure, Praktiken, Bielefeld 2018 (= texte zur populären Musik 10); oder Nikolai Okunew: Red Metal. Die Heavy-Metal-Subkultur der DDR, 2., durchgesehene Auflage, Berlin 2021.
- Vgl. Sascha Lange, Dennis Burmeister: Our Darkness. Gruftis und Waver in der DDR, Mainz 2022.
- Zur alternativen (anderen) Neuen (E-)Musik in der DDR vgl. u. a. Frank Schneider: Momentaufnahme. Notate zu Musik und Musikern in der DDR, Leipzig 1979 (= Reclams Universal-Bibliothek 785); oder Michael Berg, Albrecht von Massow, Nina Noeske (Hg.): Zwischen Macht und Freiheit. Neue Musik in der DDR, Köln, Weimar, Wien 2004 (= KlangZeiten 1); oder Nina Noeske: Musikalische Dekonstruktion. Neue Instrumentalmusik in der DDR, Köln, Weimar, Wien 2007 (= KlangZeiten 3).
- Dirk Oschmann: Der Osten: eine westdeutsche Erfindung, Berlin 2023.
- Steffen Mau: Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Berlin 2019; oder ders.: Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt, Berlin 2024 (= edition suhrkamp Sonderdruck).
- Arthur Rimbaud: „Seher-Brief“ an Paul Demeny vom 15. Mai 1871, in: ders.: Sämtliche Dichtungen. Zweisprachige Ausgabe, aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und einem Nachwort hg. von Thomas Eichhorn, München 1997, 368–379, 371.